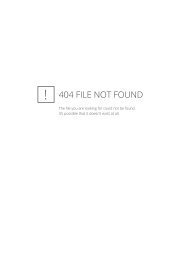Immobilisierung
resolver
resolver
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Stand der Technik<br />
Dadurch kann das Protein im Raum diffundieren und zusätzlich ist nur wenig Platz vorhanden,<br />
was im lokalen die Viskosität des Wassers etwas heraufsetzt. Dadurch wird die Umgebung,<br />
ähnlich einer Zelle, imitiert, was das Enzym weiter stabilisiert [40] .<br />
Eine weitere Möglichkeit der ungerichteten <strong>Immobilisierung</strong> ist die Bindung von Cysteingruppen<br />
in der Peripherie des nativen Enzyms an Goldoberflächen [41] . Auch hier ist wieder<br />
ein großer Verlust der Aktivität zu erwarten durch die Denaturierung der Enzyme, bei Kontakt<br />
mit der Oberfläche.<br />
Die nächste Möglichkeit ist die Verknüpfung von funktionellen Gruppen der Oberfläche,<br />
die im Vorfeld auf der Oberfläche synthetisiert werden, mit denen, die auf der Peripherie des<br />
Enzyms liegen. Zu dieser Technik gibt es verschiedene Ansätze die von der jeweiligen Elektrodenoberfläche<br />
abhängig sind. Wählt man als Ausgangsmaterial eine Glas- oder Siliciumoberfläche<br />
befindet man sich in der klassischen organischen Chemie. Die jeweiligen Siliciumatome<br />
an der Phasengrenze müssen durch Oxidationsprozesse aktiviert werden, wodurch<br />
im Allgemeinen Hydroxyde entstehen. Diese können durch klassische Verknüpfungsreaktionen<br />
mit funktionalisierten Silanen oder anderen reaktiven Kohlenstoffverbindungen weiter<br />
aufgebaut werden. Ziel ist es in jedem Fall eine terminale Gruppe zu haben, die mit milden<br />
chemischen Methoden weiter reagiert. So eignet sich besonders die EDC/NHS –Chemie zur<br />
Synthese von Amiden [25] . Dabei muss auf der Elektrodenoberfläche eine terminale organische<br />
Säure vorhanden sein, die durch die Reaktion zu einem Succinimidylester wird, der unter<br />
milden Bedingungen mit primären Aminen reagiert, wie sie im Lysin vorliegen. Lysin ist eine<br />
Aminosäure, die mit einer Häufigkeit von >10 % in Proteinen vorkommt [42] . Weitere Gruppen,<br />
die zu einer Bindungsbildung verwendet werden können sind Isothiocyanate [43] , Aldehyde<br />
[44] oder Epoxide [15,45] .<br />
Eine weitere Methode ist die Verwendung von Carbonsäuren, die auf dem Protein durch<br />
die beiden Aminosäuren Aspartat und Glutamat exponiert werden und mit zu den häufigsten<br />
Aminosäureresten auf den Oberflächen gehören. Auch hier werden wieder milde Kupplungsreagenzien,<br />
wie Carbonyldiimidazol (CDI), verwendet werden um die Aminosäuren zu aktivieren<br />
und dann auf eine mit Aminen modifizierte Oberfläche zu geben [46] . Allerdings kann<br />
bei dieser Methode die Vernetzung der Proteine untereinander, durch Reaktion mit den Aminen<br />
auf der Proteinoberfläche anderer Proteine, auftreten, was die Aktivität der einzelnen Proteine<br />
herabsetzt.<br />
5