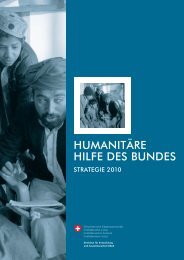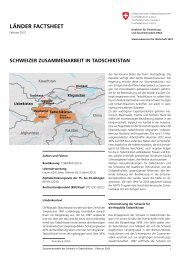12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
kung und Nachhaltigkeit von Projekten entscheidend. Einerseits sind dafür politische und organisatorische<br />
Gründe massgebend (z.B. Versetzungen), aber auch zunehmend die Konkurrenz<br />
aus Privatwirtschaft und Zivilgesellschaft, welche meistens bessere Saläre bietet als<br />
staatliche Institutionen in Osteuropa. Einige Länder weisen eine ausgeprägte Abwanderung<br />
von hochqualifizierten Arbeitskräften aus (z.B. Bulgarien), mit entsprechend negativen<br />
Rückwirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft durch den Verlust an Fachwissen und dynamischen<br />
Arbeitnehmern.<br />
Folgerungen<br />
Ø Eine erfolgreiche Unterstützung der Transition in den Partnerländern der <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />
erfordert eine starke Orientierung bezüglich individueller und gesellschaftlicher<br />
Lernprozesse, welche auf nachhaltige Veränderungen abzielen. Damit verbunden ist<br />
auch eine gemeinsame Suche nach geeigneter institutioneller Verankerung.<br />
Ø Die technische und institutionelle Nachhaltigkeit scheint weitgehend gesichert, auch<br />
wenn innovative Technologien und von der Schweiz transferiertes Wissen in den Ländern<br />
Osteuropas länger brauchen zur Verankerung als ursprünglich erwartet. Die wirtschaftliche<br />
Nachhaltigkeit wird in den Projekten jedoch unterschätzt.<br />
Ø Es wird empfohlen, die Resultate und die Nachhaltigkeit der Wirkungen (Impakt) einiger<br />
ausgewählter Projekte nach Abschluss/Übergabe ex-post zu bewerten.<br />
4.2.3 Kooperation und Lernprozesse<br />
4.2.3.1 Zusammenarbeit mit lokalen Partnern: Partizipation und “Ownership“<br />
1: Wie werden nationale und lokale Partner, Kompetenzen und Ressourcen bei der Ausgestaltung von Pr ojekten<br />
und Programmen einbezogen?<br />
2: Wie fördern Projekte und Programme in der Umsetzung Partizipation, Eigeninitiative und Ermächtigung<br />
sowie "ownership" der Partner und Begünstigten?<br />
Viele der von der OZA mandatierten Schweizer Partner gingen zu Beginn der <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />
stark von ihren Eigeninteressen (und bereits existierenden Beziehungen) aus. Das<br />
war notwendig für einen raschen Einstieg ohne Kapazitäten vor Ort. Dies hat dazu geführt,<br />
dass viele Aktivitäten lange aus den Zentralen der Schweizer Partner gesteuert wurden. Ende<br />
der 90er <strong>Jahre</strong> wurden dann von der <strong>DEZA</strong> bewusst die lokalen Partner in den Vordergrund<br />
gestellt. So wurden die lokalen Umsetzungskapazitäten in den letzten 5 <strong>Jahre</strong>n durch<br />
gezielte Aus- und Fortbildungsmassnahmen sowie ausgewogenere Partnerschaften gestärkt.<br />
Während die erste Generation von Projekten noch ausschliesslich von der Schweiz aus koordiniert<br />
wurde, ergab sich eine deutliche Verlagerung der Verantwortlichkeiten für die Projektplanung<br />
und Steuerung zu den lokalen Partnern, die aber noch nicht abgeschlossen ist.<br />
Die frühere Dominanz der schweizerischen Partner hat zum Teil den Aufbau von dauerhaften<br />
lokalen Institutionen behindert (z.B. Bulgarien). In den letzten <strong>Jahre</strong>n wurden diesbezüglich<br />
deutliche Fortschritte gemacht. Viele der neueren <strong>DEZA</strong>-Projekte bauen lokale Projektorganisationen<br />
wie Stiftungen/Verbände und NGOs auf, welche gute Aussichten für einen<br />
dauerhaften Erfolg haben und lokal verwurzelt sind. Die Eröffnung von <strong>DEZA</strong>/seco Kooperationsbüros<br />
in den Schwerpunktländern hat diese Kompetenzverlagerung und Dezentralisierung<br />
der Projektumsetzung zusätzlich begünstigt und vereinfacht.<br />
Lokale Ressourcen und Kompetenzen sind oft eng mit Strukturen und Einstellungen aus der<br />
kommunistischen Periode verbunden, deren Überwindung ein Ziel der Unterstützung des<br />
Transitionsprozesses ist. Deshalb gilt es bestehende Ressourcen und Kompetenzen anzureichern<br />
und in einem neuen Kontext (Demokratie, Marktwirtschaft) nutzbar zu machen. Es<br />
stellt sich zum Beispiel die Frage, wie im sowjetischen System sozialisierte Journalisten trai-<br />
78