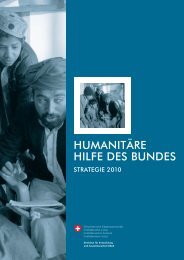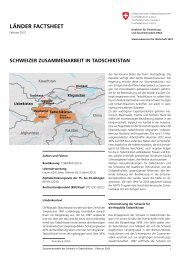12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
tätig (z.B. seco in der Infrastruktur und Umwelt/Energie, die <strong>DEZA</strong> im Bereich Gouvernanz/Demokratie).<br />
Eine Reduktion der Anzahl der Sektoren in gemeinsamen Programmen<br />
ist nur möglich, wenn die Programme zwischen seco und <strong>DEZA</strong> thematisch enger abgestimmt<br />
werden. Dem Vorteil der stärkeren Fokussierung stünde der Nachteil der geringeren<br />
inhaltlichen Flexibilität gegenüber.<br />
Mit dem Instrument der Landesprogramme konnte die wachsende Programmvielfalt in der<br />
schweizerischen <strong>Ostzusammenarbeit</strong> in den letzten <strong>Jahre</strong>n kanalisiert werden. Eine weitergehende<br />
Fokussierung der Sektoren in den einzelnen Ländern würde eine intensivere Koordination<br />
<strong>DEZA</strong>-seco (siehe Kapitel 4.5) und das Schnüren von grösseren gemeinsamen Vorhaben<br />
bedingen sowie eine rigorosere Auswahl der Projekte voraussetzen. Eine stärkere<br />
Fokussierung der Projekte oder eine Reduktion der Zahl der Sektoren in den Landesprogrammen<br />
könnte die Kohärenz und das Gewicht des schweizerischen Beitrages - vor allem<br />
im Politikdialog - weiter steigern.<br />
Eine verstärkte Konzentration auf weniger Schwerpunktländer hätte dagegen weniger Wirkung,<br />
weil die Schweiz heute ein insgesamt kleiner – aber dennoch wichtiger - Geber ist, 20<br />
Auch bei einer Konzentration der Mittel auf gewisse Länder kann nicht unbedingt ein signifikanter<br />
Grösseneffekt erzielt werden, da selbst bei einer substantiellen Ausweitung des Programms<br />
die Schweiz ein relativ kleiner Geber bleibt. Qualitativ hochwertige und innovative<br />
Projekte in ausgewiesenen Nischen und Sektoren, in welchen die Schweiz Stärken hat, sind<br />
demzufolge eine angemessene Strategie (siehe Abschnitt „Know-how Einsatz/Lessons<br />
learnt“ und Fallbeispiele Bulgarien und Kirgisistan).<br />
Folgerungen<br />
Ø Die Sektoren „Gouvernanz/Demokratie“ und „Gesundheit/Soziales“ absorbieren mehr als<br />
40 % der verpflichteten Mittel. Ihre Bedeutung hat im Verlauf der Zeit relativ zugenommen<br />
und entspricht damit den Herausforderungen der Transition mit ihren Schattenseiten.<br />
Ø Mit 2-3 Sektoren pro Landesprogramm könnten mehr Synergien, eine grössere Wirkung,<br />
und ein besserer Politikdialog erzielt werden. Dies muss aber Einzelfallweise an den<br />
Landesprogrammen überprüft werden und verlangt eine stärkere Abstimmung der Sektoren<br />
(und Projekte) zwischen <strong>DEZA</strong> und seco.<br />
Ø Die Themenvielfalt innerhalb der Sektoren ist beachtlich (z.B. Gouvernanz reicht von<br />
Modellgefängnissen, Gemeindeentwicklung, Reform Katasterwesen, Medien (spez. Radio),<br />
Menschenrechten, Gewerkschaften bis zu „E-Governance“). Es ist zu prüfen ob mittels<br />
besserer Fokussierung der Projekte der Betreuungsaufwand und der Beitrag zum<br />
Politikdialog verbessert werden kann.<br />
Ø Die Konsistenz der Zuordnung von Projekten zu Sektoren in der <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />
sollte verbessert und die Klassierung bezüglich Partner bei jeder Projektphase aktualisiert<br />
werden.<br />
c) Organisatorische Anpassungen<br />
Zwischen 1991 und 1995 hatte das im EDA angesiedelte Büro für die Zusammenarbeit mit<br />
Osteuropa (BZO) die Federführung der schweizerischen <strong>Ostzusammenarbeit</strong> inne. Diese<br />
operierte damals weitgehend auf Neuland, ebenso wie die anderen Geber. Politische Fragestellungen<br />
und Opportunitäten beeinflussten die operative Projektabwicklung erheblich und<br />
diverse Schweizer Politiker waren in dieser Phase selber aktiv in der Projektumsetzung involviert.<br />
Es gab in Einzelfällen massiven Druck auf Sachbearbeiter in der Zentrale.<br />
20 In Bulgarien, Rumänien und Kirgisistan wird die Schweiz im Durchschnitt der <strong>Jahre</strong>n 2000 und 2001 als je sechstgrösster<br />
Geber klassiert. Die Beiträge liegen jedoch um Faktoren hinter den 3 grössten Gebern (EU, USA und Japan zurück). Quelle<br />
DAC Statistiken 2000/2001.<br />
62