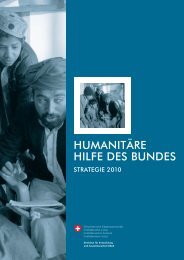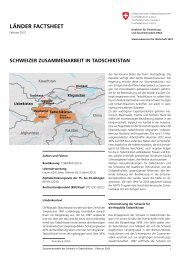12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ø Für verschiedene mittel- und zentraleuropäische Transitionsländer wird die EU ab Mitte<br />
der 90-er <strong>Jahre</strong> wichtig. Sie richten sich fortan auf die EU aus, die Schweiz und deren<br />
Zusammenarbeit treten in den Hintergrund. Danach versuchte das seco noch in erster<br />
Linie im Bereiche der Joint Implementation (Klimaschutz / Kyoto-Protokoll) mit den EU-<br />
Kandidaten zusammenzuarbeiten. Die Joint Implementation erlaubte es ja auch, Versuche<br />
zu machen.<br />
Ø Im Vergleich zur EU ist der Beitrag der Schweiz relativ klein. Um so mehr muss die <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />
Nischenstellungen einnehmen. Statt auf nationaler Ebene und in Projekten<br />
von nationaler Bedeutung kann die <strong>Ostzusammenarbeit</strong> durchaus gezielt in mittleren<br />
Städten, wie beispielsweise auch auf Gemeindeebene 14 , genügend Relevanz erreichen<br />
und dort auch Einfluss auf den politischen Dialog ausüben 15 .<br />
Ø Eine weitere Nische des seco war im bisherigen Transitionsprozess die Rehabilitation<br />
und das Sicherstellen von Infrastrukturanlagen, die vor <strong>Jahre</strong>n noch Bezug zur Schweizer<br />
Industrie hatten. In diesen Fällen machte (und macht weiterhin) die Rehabilitation<br />
auch Sinn. Dasselbe gilt für die Kataster; auch in diesem Bereiche verfügt die Schweiz<br />
über gute Erfahrung und lieferten Schweizer Firmen schon früher Geräte. 16<br />
Ø Im Bereiche der Handelsförderung macht eigentlich nur das CBS (Holland) ähnliche Arbeit<br />
wie das seco. Das CBS fördert Importe in die Europäische Union. In Sachen Biozertifizierung<br />
hat das seco ebenfalls eine klare Nische gefunden; es gibt neben dem Seco lediglich<br />
kleinere, punktuelle Projekte mit schwedischer Unterstützung wie auch im rein<br />
kommerziellen Bereich.<br />
Ø Mit Blick auf die komparativen Vorteile schweizerischer Technologie gibt die <strong>Evaluation</strong><br />
des Landesprogramms mit der Tschechischen Republik verschiedene Hinweise, u.a. wird<br />
dort betont, dass die schweizerische Industrie ihre Wettbewerbsvorteile vorab bei “High<br />
Tech“ – Produkten ausspielen konnte und dass die Frage lokaler Vertretungen der Firmen<br />
sich als mitentscheidender Faktor für die Nachhaltigkeit auswirkte (auch im Sinne<br />
des Aufbaus kommerzieller Beziehungen).<br />
c) Vergleich mit den multilateralen Programmen (im Bereiche Finanzielle Zusammenarbeit)<br />
Ø Bei den Projekten der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds und der EBRD steht<br />
das Kreditinstrumentarium im Vordergrund (d.h. es handelt sich um rückzahlbare Kredite<br />
[Loans]); die Zusammenarbeit des seco mit den Transitionsländern dagegen basiert auf<br />
nicht rückzahlbaren Krediten [Grants]. Dieser Unterschied ist insbesondere in der zentralasiatischen<br />
Region wesentlich, wo ja die Auslandverschuldung zu einem absolut vordringlichen<br />
Problem geworden ist.<br />
Ø Projekte, die auf rückzahlbaren Krediten beruhen, fallen für das Land meist auch teurer<br />
aus. So können derartige Projekte zu Tariferhöhungen führen, falls sie nicht mit nichtrückzahlbaren<br />
Komponenten ergänzt werden. Beispielsweise werden Projekte der EBRD<br />
von Ressourcepersonen als relativ teuer eingestuft.<br />
Ø In Zusammenhang mit Co- und Parallel-Finanzierung zu multilateralen Vorhaben hat der<br />
Beitrag des seco insofern eine Schlüsselstellung, als mit nicht rückzahlbaren Krediten vitale<br />
Bereiche finanziert werden, mit Blick darauf, die Auslandverschuldung gegenüber<br />
den multilateralen Krediten in den akzeptablen Grenzen zu halten.<br />
Ø Bei den genannten multilateralen Finanzierungsprojekten handelt es sich stets um grössere<br />
Vorhaben (oft > 100 Mio CHF). In deren Grössenklasse kommt der politische Dialog<br />
sozusagen natürlich hinzu. Dagegen liegt wohl das Volumen der meisten seco-Beiträge<br />
14 Siehe auch den Ansatz zur Gemeindeförderung der Deza.<br />
15 Beispiel Verkehr: die EU setzt auf den Transitverkehr. Der Regionalverkehr vieler städtischer Agglomerationen bricht aber<br />
zunehmend zusammen. Das gleichzeitige Wachstum des Privatverkehrs trägt zur Luftverschmutzung bei. Die Schweiz hat<br />
gute Erfahrung im Regionalverkehr und könnte in diesem Bereich sehr wohl eine Nischenstellung einnehmen.<br />
16 Mit Blick auf einen Beitrag zum politischen Dialog sind die Möglichkeiten bei Energieprojekten eher gering, da es sich meist<br />
um nationale Vorhaben handelt und damit das “Leverage“ des seco limitiert ist; dagegen sind diese im Sektor Wasser vergleichsweise<br />
grösser, da es sich oft um einen dezentralisierten Sektor handelt, und damit das seco auf mehr lokaler Ebene<br />
durchaus einen relevanten “Leverage“ erreichen kann.<br />
51