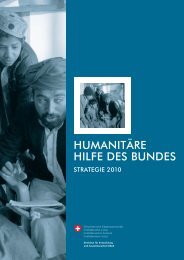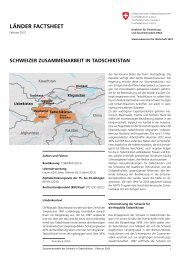12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Als die <strong>DEZA</strong> 1995 mit der Umsetzung der <strong>Ostzusammenarbeit</strong> betraut wurde, lagen noch<br />
keine gesicherten Erfahrungen vor, wie die Transition abläuft. Es gab zwar Theorien, aber<br />
diese waren nicht verifiziert. Das Programm der <strong>Ostzusammenarbeit</strong> war in dieser Phase<br />
heterogen und geprägt durch das Realisieren von Opportunitäten ohne ausreichende strategische<br />
Grundlagen.<br />
Aufgrund der festgestellten strategischen und organisatorischen Schwächen, sowie des Berichtes<br />
der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommission zur Inspektion der <strong>Ostzusammenarbeit</strong><br />
1995, reorganisierte die <strong>DEZA</strong> die <strong>Ostzusammenarbeit</strong> in der Folge zügig. Die<br />
sektorielle und thematische Struktur wurde zugunsten einer geografischen Orientierung - wie<br />
in der Südzusammenarbeit - abgelöst. Das Organigramm und die Verantwortlichkeiten wurden<br />
neu definiert. Die damalige AZO musste zu Beginn viel Strategie- und Konzeptarbeit<br />
leisten, unter anderem für die interne Abstützung und Meinungsbildung. Während der Umstrukturierung<br />
wurde innerhalb von 3 <strong>Jahre</strong>n das ganze Team erneuert. Es waren nachher<br />
Experten mit der Zusammenarbeit in Osteuropa betraut, welche konkrete Erfahrungen aus<br />
der Internationalen Zusammenarbeit mitbrachten. Diese relativ schwierige, aber rasch<br />
durchgeführte Transition innerhalb der <strong>DEZA</strong> wurde zur späteren Stärke, denn die Folgen<br />
der kriegerischen Ereignisse in Südosteuropa und der Ausstieg aus Mitteleuropa verlangten<br />
pragmatisches Handeln und ein hohes Mass an Flexibilität.<br />
d) Veränderte Problemwahrnehmung<br />
Die ursprüngliche Annahme, wonach die Transition in erster Linie eine Frage von gezielten<br />
wirtschaftlichen Investitionen und flankierenden Maßnahmen in der Ausbildung und Organisationsentwicklung<br />
sei, hat sich als falsch erwiesen. Nicht das (fehlende) Geld, sondern fehlendes<br />
Wissen war in diesen Ländern das Hauptproblem. Einerseits hatten die Länder Osteuropas<br />
zwar generell gut ausgebildete Leute, aber niemand überprüfte dies bezüglich ihrer<br />
Tauglichkeit in neuen Wirtschafts- und Sozialsystemen. Die teilweise Hyperspezialisierung<br />
einerseits sowie fehlende Kenntnisse in moderner Betriebswirtschaft, Organisationsentwicklung<br />
und Management andererseits, erwiesen sich bald als Hürden im Aufbau von effizienten<br />
Verwaltungsstrukturen und griffigen Gesetzgebungen. Es wurde unterschätzt, dass die<br />
kommunistische Sozialisierung die Verhaltensweisen und Problemlösungsverfahren bis auf<br />
die Stufe der Familien und Individuen stark geprägt hatte. Ein schneller Systemwechsel<br />
konnte zwar die Oberfläche verändern, aber die notwendigen gesellschaftlichen und individuellen<br />
Lernprozesse zur nachhaltigen Verankerung demokratischer und marktwirtschaftlicher<br />
Strukturen dauern länger (als anfangs vermutet).<br />
Den nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1992 entstandenen GUS Staaten fehlte in<br />
der Regel die Erfahrung als eigenständiger Nationalstaat. Entsprechende Institutionen wie<br />
Verfassung, Bankenwesen und Steuerbehörden mussten faktisch aus dem Nichts aufgebaut<br />
werden. Nachdem die zuerst angewandten Schocktherapien (z.B. Privatisierung in Russland)<br />
versagten und einige Länder die Reformen nur sehr zögerlich oder oberflächlich angingen,<br />
erkannte die <strong>DEZA</strong> die Bedeutung fundierter Kontextkenntnisse dieser Länder für eine<br />
angepasste und erfolgreiche Unterstützung im Transitionsprozess. Die <strong>DEZA</strong> hat dies konkret<br />
umgesetzt, indem relativ rasch neue Kooperationsbüros in den Schwerpunktländern eröffnet<br />
wurden. Das rasche Reagieren der Schweiz auf diese Herausforderung hat dazu geführt,<br />
dass die Schweiz vielerorts bereits vor anderen Gebern substantielle Programme eröffnen<br />
konnte (z.B. Zentralasien, Südkaukasus). Das frühe schweizerische Engagement in<br />
Zentralasien und in Serbien stand im Rahmen des Aufbaus und der Stärkung der Schweizer<br />
Position als Stimmrechtsvertreter bei der Weltbank und IMF 21 sowie bei der EBRD 22 .<br />
21 Aserbaidschan, Kirgisistan, Polen, Serbien, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.<br />
22 Zusätzlich Liechtenstein und die Türkei, aber ohne Polen und Tadschikistan.<br />
63