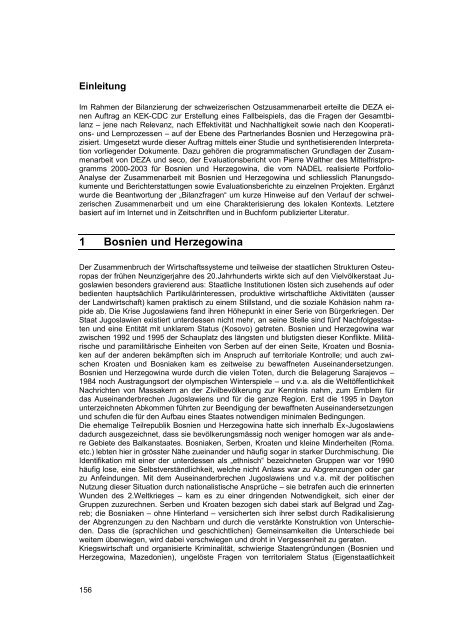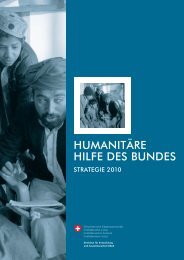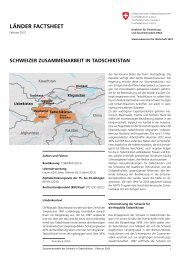12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Einleitung<br />
Im Rahmen der Bilanzierung der schweizerischen <strong>Ostzusammenarbeit</strong> erteilte die <strong>DEZA</strong> einen<br />
Auftrag an KEK-CDC zur Erstellung eines Fallbeispiels, das die Fragen der Gesamtbilanz<br />
– jene nach Relevanz, nach Effektivität und Nachhaltigkeit sowie nach den Kooperations-<br />
und Lernprozessen – auf der Ebene des Partnerlandes Bosnien und Herzegowina präzisiert.<br />
Umgesetzt wurde dieser Auftrag mittels einer Studie und synthetisierenden Interpretation<br />
vorliegender Dokumente. Dazu gehören die programmatischen Grundlagen der Zusammenarbeit<br />
von <strong>DEZA</strong> und seco, der <strong>Evaluation</strong>sbericht von Pierre Walther des Mittelfristprogramms<br />
2000-<strong>2003</strong> für Bosnien und Herzegowina, die vom NADEL realisierte Portfolio-<br />
Analyse der Zusammenarbeit mit Bosnien und Herzegowina und schliesslich Planungsdokumente<br />
und Berichterstattungen sowie <strong>Evaluation</strong>sberichte zu einzelnen Projekten. Ergänzt<br />
wurde die Beantwortung der „Bilanzfragen“ um kurze Hinweise auf den Verlauf der schweizerischen<br />
Zusammenarbeit und um eine Charakterisierung des lokalen Kontexts. Letztere<br />
basiert auf im Internet und in Zeitschriften und in Buchform publizierter Literatur.<br />
1 Bosnien und Herzegowina<br />
Der Zusammenbruch der Wirtschaftssysteme und teilweise der staatlichen Strukturen Osteuropas<br />
der frühen Neunzigerjahre des 20.Jahrhunderts wirkte sich auf den Vielvölkerstaat Jugoslawien<br />
besonders gravierend aus: Staatliche Institutionen lösten sich zusehends auf oder<br />
bedienten hauptsächlich Partikulärinteressen, produktive wirtschaftliche Aktivitäten (ausser<br />
der Landwirtschaft) kamen praktisch zu einem Stillstand, und die soziale Kohäsion nahm rapide<br />
ab. Die Krise Jugoslawiens fand ihren Höhepunkt in einer Serie von Bürgerkriegen. Der<br />
Staat Jugoslawien existiert unterdessen nicht mehr, an seine Stelle sind fünf Nachfolgestaaten<br />
und eine Entität mit unklarem Status (Kosovo) getreten. Bosnien und Herzegowina war<br />
zwischen 1992 und 1995 der Schauplatz des längsten und blutigsten dieser Konflikte. Militärische<br />
und paramilitärische Einheiten von Serben auf der einen Seite, Kroaten und Bosniaken<br />
auf der anderen bekämpften sich im Anspruch auf territoriale Kontrolle; und auch zwischen<br />
Kroaten und Bosniaken kam es zeitweise zu bewaffneten Auseinandersetzungen.<br />
Bosnien und Herzegowina wurde durch die vielen Toten, durch die Belagerung Sarajevos –<br />
1984 noch Austragungsort der olympischen Winterspiele – und v.a. als die Weltöffentlichkeit<br />
Nachrichten von Massakern an der Zivilbevölkerung zur Kenntnis nahm, zum Emblem für<br />
das Auseinanderbrechen Jugoslawiens und für die ganze Region. Erst die 1995 in Dayton<br />
unterzeichneten Abkommen führten zur Beendigung der bewaffneten Auseinandersetzungen<br />
und schufen die für den Aufbau eines Staates notwendigen minimalen Bedingungen.<br />
Die ehemalige Teilrepublik Bosnien und Herzegowina hatte sich innerhalb Ex-Jugoslawiens<br />
dadurch ausgezeichnet, dass sie bevölkerungsmässig noch weniger homogen war als andere<br />
Gebiete des Balkanstaates. Bosniaken, Serben, Kroaten und kleine Minderheiten (Roma.<br />
etc.) lebten hier in grösster Nähe zueinander und häufig sogar in starker Durchmischung. Die<br />
Identifikation mit einer der unterdessen als „ethnisch“ bezeichneten Gruppen war vor 1990<br />
häufig lose, eine Selbstverständlichkeit, welche nicht Anlass war zu Abgrenzungen oder gar<br />
zu Anfeindungen. Mit dem Auseinanderbrechen Jugoslawiens und v.a. mit der politischen<br />
Nutzung dieser Situation durch nationalistische Ansprüche – sie betrafen auch die erinnerten<br />
Wunden des 2.Weltkrieges – kam es zu einer dringenden Notwendigkeit, sich einer der<br />
Gruppen zuzurechnen. Serben und Kroaten bezogen sich dabei stark auf Belgrad und Zagreb;<br />
die Bosniaken – ohne Hinterland – versicherten sich ihrer selbst durch Radikalisierung<br />
der Abgrenzungen zu den Nachbarn und durch die verstärkte Konstruktion von Unterschieden.<br />
Dass die (sprachlichen und geschichtlichen) Gemeinsamkeiten die Unterschiede bei<br />
weitem überwiegen, wird dabei verschwiegen und droht in Vergessenheit zu geraten.<br />
Kriegswirtschaft und organisierte Kriminalität, schwierige Staatengründungen (Bosnien und<br />
Herzegowina, Mazedonien), ungelöste Fragen von territorialem Status (Eigenstaatlichkeit<br />
156