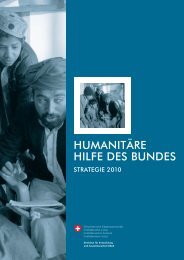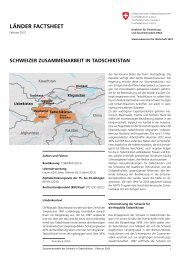12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
derung, (3) Handelsförderung sowie (4) die Zahlungsbilanzhilfe, Entschuldungsmassnahmen<br />
und Finanzsektorunterstützung. Als eine spezielle Art gehören die Kreditgarantien dazu.<br />
2.3 Kernaussagen zur Transition gemäss Transitionsanalyse<br />
(Zusammenfassung aus A. Melzer: <strong>12</strong> <strong>Jahre</strong> <strong>Ostzusammenarbeit</strong>. Die Transition und ihr Schatten. <strong>Evaluation</strong> EE<strong>2003</strong>/4, <strong>Band</strong> 1)<br />
Das Ende der kommunistischen Herrschaftssysteme und die Auflösung der Sowjetunion zu<br />
Beginn der 90er <strong>Jahre</strong> hatte zwei fundamentale Ursachen: das sozialistische System war<br />
politisch nicht mehr legitimierbar und wirtschaftlich nicht mehr finanzierbar. Dies hat in Osteuropa<br />
einen Umbruch von historischen Dimensionen ausgelöst. Er umfasst den Übergang<br />
von der sozialistischen Einparteienherrschaft zur parlamentarischen Demokratie und von der<br />
Planwirtschaft zur Marktwirtschaft. Ideologisch zwangsvereinheitlichte und abgeschottete<br />
Gesellschaften mutieren zu pluralistischen und offenen Gesellschaften.<br />
Die Entlassung in die politische und wirtschaftliche Unabhängigkeit hat in mehreren Ländern<br />
zu schweren Konflikten und Kriegen geführt, nicht nur verbunden mit grossem, menschlichen<br />
Leiden und Zerstörungen, sondern ebenso mit umfangreichen Flüchtlingsströmen, die auch<br />
die westlichen Länder erreichten.<br />
Politisch wurden die ersten Reformschritte (Aufhebung des Parteiprimats, freie Wahlen, Anerkennung<br />
der Menschenrechte) durch Verfassungsreformen vorgenommen. Der wirtschaftliche<br />
und soziale Transformationsprozess verlief in drei sich überschneidenden Phasen: Liberalisierung<br />
und Makrostabilisierung, Privatisierung, institutionelle Reformen. Die ersten Reformschritte<br />
lösten zunächst in allen Transitionsländern massive Wirtschaftskrisen mit gravierenden<br />
Verschlechterungen der Lebensverhältnisse grosser Bevölkerungsteile aus.<br />
Die bislang erreichten Transitionserfolge variieren stark und weisen geografisch ein deutliches<br />
Gefälle von Nordwesten nach Südosten auf. Die erfolgreichsten Reformer sind die<br />
Länder mit Kurs auf die EU, wobei diese Perspektive für rund die Hälfte der 27 Transitionsländer<br />
besteht: für acht Beitrittskandidaten im Jahr 2004, für zwei bis drei Länder in den <strong>Jahre</strong>n<br />
2007/08, und für einige der Mitglieder des Stabilitätspakts für Südosteuropa zu einem<br />
vorläufig noch unbekannten Zeitpunkt. In den sieben ärmsten GUS-Staaten steht die Bekämpfung<br />
der Armut als Entwicklungsziel im Vordergrund. In den anderen Transitionsländern<br />
(vor allem Russland und Ukraine) sind gut fokussierte gesamtgesellschaftliche Entwicklungsperspektiven<br />
kaum zu erkennen.<br />
Beim Aufbau wirtschaftlicher und sozialer Institutionen bestätigt sich, dass die Institutionalisierung<br />
ungleich schleppender vor sich geht und erst einige Zeit nach den Makro- und Mikroreformen<br />
zu greifen beginnt. Die EU Kandidaten haben sich bis heute in ihren Institutionen<br />
westlichen Standards zu etwa 80% angenähert. Die übrigen Länder erreichen mit starker<br />
Streuung zwischen 40 bis 60%. Die Mehrzahl dieser Länder kämpft nach wir vor mit erheblichen<br />
Problemen der Armut und Perspektivlosigkeit grosser Bevölkerungsteile, mit Problemen<br />
des Rent-seeking und endemischer Korruption sowie dem andauernden Raubbau an<br />
Umweltgütern und natürlichen Ressourcen.<br />
Der Umbau der Institutionen ist so komplex und zeitraubend, weil er sich auf dem Substrat<br />
der Lebensumstände der Menschen vollzieht. Die Institutionen werden ihre Nachhaltigkeit im<br />
Sinne dauerhafter Stabilität erst erreichen, wenn die Werte, Normen und das Verhalten der<br />
Mitglieder der Gesellschaften sie auch tragen. Daher ist die Transition erst abgeschlossen,<br />
wenn die neuen Institutionen rechtlich, wirtschaftlich und sozial ein menschenwürdiges Dasein<br />
erlauben und ermöglichen. Insbesondere die ärmeren Transitionsländer sind davon<br />
noch weit entfernt.<br />
5