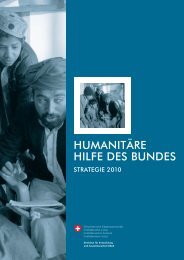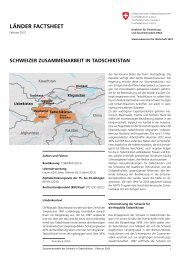12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
12 Jahre Ostzusammenarbeit - Evaluation 2003/4 - Band 2 - DEZA
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
nur die ausgebildeten Ärzte, Spezialisten oder Beamten. Aufgrund der uneinheitlichen Klassierung<br />
von Begünstigen in den <strong>DEZA</strong> Projekten sind deshalb lediglich grobe Trends sichtbar.<br />
Die markanteste Veränderung zwischen der Periode 1992-94 und 2000-02 betrifft die eindeutige<br />
Zunahme der Kategorie „Minderheiten“ (inkl. Flüchtlinge von 0 auf 6%) als Folge der<br />
Versöhnungsanstrengungen zwischen den verfeindeten Volksgruppen auf dem Balkan und<br />
die starke Abnahme der Bedeutung der „Unternehmen“ (von 19 auf 9%) als direkt Begünstigte,<br />
auch hier ist der Grund der <strong>DEZA</strong>-Ausstieg in Mitteleuropa ab Mitte der 90er <strong>Jahre</strong>.<br />
82<br />
Schwerpunktverschiebung der <strong>DEZA</strong>-Mittel nach Begünstigen<br />
Verteilung nach Begünstigen 1992-94<br />
(CHF 77 Millionen)<br />
10%<br />
10%<br />
0% 1% 9%<br />
26%<br />
Verteilung nach Begünstigen 2000-02<br />
(CHF 263 Millionen)<br />
Abbildung 23: Prozentuale Schwerpunktverschiebung der verpflichteten <strong>DEZA</strong> -Mittel nach Begünstigen<br />
(Quelle: Portfolio-Analyse)<br />
Auch bei den Begünstigten sind die regionalen Unterschiede erheblich: In den EU Beitrittsländern<br />
standen die „spezifischen Berufsgruppen“ und der „Privatsektor“ im Vordergrund, in<br />
Südosteuropa „spezifische Berufsgruppen“, in den GUS-7 Ländern die „ländliche Bevölkerung“<br />
und in der Rest-GUS ganz klar der „Privatsektor“. Die Projekte haben damit relevante<br />
und dem Stand der Transition angepasste Zielgruppen anvisiert. Deutlich ist die Zweiteilung<br />
in „ländliche Bevölkerung“ und „Übrige Bevölkerung“ sowie „Minderheiten“ als Begünstigte<br />
vorab im sozialen Bereich und den „Unternehmen“ und „spezifischen Berufsgruppen“ zur<br />
Stärkung der marktwirtschaftlichen Prinzipien andererseits.<br />
Folgerungen<br />
7%<br />
18%<br />
19%<br />
15%<br />
10%<br />
4%<br />
6%<br />
4%<br />
Ø Die Abklärung von Kompetenzen, Motivation und Interessen der Partner, sowohl auf<br />
Schweizer wie auch auf lokaler Seite muss frühzeitig und sorgfältig erfolgen und während<br />
der Umsetzung kontinuierlich beobachtet werden.<br />
Ø Die Professionalität der Schweizer Partner und die Ausrichtung der Programme an die<br />
lokalen Bedürfnissen hat sich verbessert. Die Rolle und Verantwortung von lokalen Partnern<br />
wurde in den letzten <strong>Jahre</strong>n deutlich gestärkt. Zur optimalen Nutzung der lokalen<br />
Kompetenzen sollten die Schweizer Partner noch vermehrt die Rolle eines Coaches oder<br />
Backstoppers übernehmen und die Implementation an lokale Träger übergeben.<br />
Ø Die Zusammenarbeit mit anderen Geberorganisationen (bi- und multilateralen) wurde erhöht.<br />
Dies ist eine wichtige Voraussetzung für eine Abstimmung unter den Gebern und<br />
einen konstruktiven Politikdialog mit dem Empfängerland.<br />
26%<br />
8%<br />
18%<br />
9%<br />
Ministerien/Ämter<br />
Lokale Institutionen<br />
Privatsektor<br />
Spez. Berufsgruppen<br />
Ländliche Bev.<br />
Übrige Bevölkerung<br />
Minderh./Flüchtlinge<br />
Intern (Deza)<br />
Andere