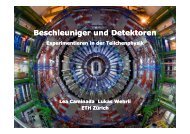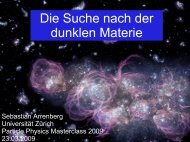Physik A Teil 1: Mechanik - Physik-Institut - Universität Zürich
Physik A Teil 1: Mechanik - Physik-Institut - Universität Zürich
Physik A Teil 1: Mechanik - Physik-Institut - Universität Zürich
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Sèvres (Paris) aufbewahrt wird. Es entspricht ungefähr der Masse von 1 l Wasser bei<br />
3.98 0 C. Die Konstanz dieser Masse z.B. durch Staub und Abrieb beeinflusst ist ca 2.5·10 −8 .<br />
Die Basisgrössen in Einheiten-Systemen können verschieden gewählt werden 9 .<br />
Hierbei sollten folgende Randbedingungen beachtet werden:<br />
(i) Die Anzahl Einheiten sind auf ein Minimum beschränkt.<br />
(ii)Die Bildung neuer Grössen (nicht Dimensionen) soll nur durch Multiplikationen und<br />
Divisionen bestehender Grössen bestimmt werden, nicht aber durch gebrochene Exponenten.<br />
An der 11. Generalkonferenz für Masse und Gewichte wurde 1960 ein kohärentes Einheitssystem,<br />
das Systeme International d’Unitès (SI), für den allgemeinen Gebrauch empfohlen.<br />
Die der Konvention angehörenden Staaten sind gehalten, das SI (siehe Anhang B)<br />
durch Gesetz einzuführen, es ersetzt alle früheren Masssysteme, wie das cgs, das MKS<br />
oder das technische System.<br />
In der Atomphysik, der Astrophysik und in der theoretischen <strong>Physik</strong> ist es jedoch oft<br />
zweckmässig, eigene Systeme einzuführen 10 .<br />
1 Kinematik des Massenpunktes<br />
1.1 Ort und Bahn<br />
Der Ort eines Massenpunktes m wird relativ zu einem Bezugspunkt ○ (Origio = Ursprung)<br />
angegeben, und zwar durch den sog. Ortsvektor ⃗r, der von ○ zum Ort des<br />
Massenpunktes zeigt. Die Spitze dieses Ortsvektors, d.h. die Funktion ⃗r = ⃗r(t), folgt der<br />
Bahn und beschreibt so die Bewegung im Laufe der Zeit.<br />
Wir haben hier die geometrische Interpretation des Vektors als gerichteter Geradenabschnitt<br />
benutzt. Der Vektor ist also durch seine Länge (Betrag) und seine Richtung<br />
festgelegt. Da man Vektoren addieren kann (Vektorparallelogramm), kann man umgekehrt<br />
den Ortsvektor auch in Komponenten zerlegen.<br />
z<br />
✻<br />
⃗r ✟✯ m<br />
⃗ k ✻<br />
✟❢<br />
✲<br />
✟✟✟✟ ⃗i ✠ ⃗j <br />
<br />
✠<br />
x<br />
✲ y<br />
Häufig wird dazu ein kartesisches Koordinatensystem benutzt,<br />
das durch drei aufeinander senkrecht stehende Einheitsvektoren<br />
⃗i, ⃗j, ⃗ k aufgespannt wird. Es gilt dann<br />
⃗r(t) = x(t)⃗i + y(t)⃗j + z(t) ⃗ k oder ⃗r(t) =<br />
⎛<br />
⎜<br />
⎝<br />
x(t)<br />
y(t)<br />
z(t)<br />
Allgemein kann also ein räumlicher Vektor durch drei skalare Grössen x, y, z ersetzt<br />
werden. Der Betrag ist r = |⃗r| = √ x 2 + y 2 + z 2 . Man beachte: In einem Experiment<br />
können nur skalare Grössen gemessen werden.<br />
Der Endpunkt von ⃗r(t) beschreibt die Bahn von m. Sind die Ortskoordinaten als<br />
Funktion der Zeit t vorgegeben, so lässt sich daraus durch Elimination von t die Bahnkurve<br />
(Parameterdarstellung einer Kurve) berechnen. Wie z.B. x = a · t, y = b · t 2 und damit<br />
die Parabelbahn y = b · x 2 /a 2 .<br />
9 Fleischmann Zeitschrift für <strong>Physik</strong> 129(1951)377; Kamke, Krämer <strong>Physik</strong>alische Grundlagen der<br />
Masseinheiten 1977 S19, vgl. Zusammenfassung Anhang B.1.5.<br />
10 z.B. c = ¯h = m e c 2 = 1 in der theoretischen <strong>Physik</strong>.<br />
⎞<br />
⎟<br />
⎠<br />
3