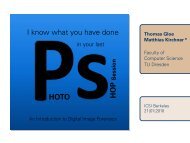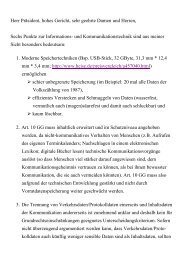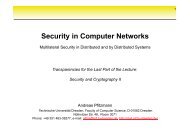Gutachten (PDF) - Professur Datenschutz und Datensicherheit ...
Gutachten (PDF) - Professur Datenschutz und Datensicherheit ...
Gutachten (PDF) - Professur Datenschutz und Datensicherheit ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
II. Empirische Gr<strong>und</strong>lagen<br />
Phonographen (d.h. die Audioaufzeichnung auf einer Zinnwalze) erfand, 16 war nicht vorstellbar,<br />
dass sich das Anhören von Musik mittels einer „Tonkonserve“ einmal zu einem Massenmarkt<br />
entwickeln würde. Es dauerte dann auch bis zum Jahr 1947 bis die ersten Langspielplatten<br />
auf den Markt kamen. 17 Musikpiraterie war zu dieser Zeit <strong>und</strong> auch später allerdings kein sehr<br />
großes Problem, da es zumindest für die Masse der Verbraucher keine Geräte zu kaufen gab,<br />
die eine Überspielung von Schallplatten auf ein anderes Medium ermöglicht hätten. Dies änderte<br />
sich allerdings gr<strong>und</strong>legend, als die Firma Philips im Jahr 1963 die Audiokassette einführte<br />
<strong>und</strong> in den Folgejahren von der Firma Dolby die Rauschunterdrückung für Audiokassetten entwickelt<br />
wurde: 18 Ab diesem Zeitpunkt konnte praktisch jedermann Kopien von Schallplatten<br />
in zumindest akzeptabler Qualität erstellen. Eine „Explosion“ erlebte der Audiokassettenmarkt<br />
dann ab dem Jahr 1979 als Sony den so genannten Walkman 19 – einen portablen Audiokassettenspieler<br />
– in den Vertrieb brachte.<br />
Trotz der einfachen <strong>und</strong> insbesondere billigen Kopierbarkeit von Schallplatten wurde die Plattenindustrie<br />
durch das Problem der Raubkopien jedoch noch nicht in gravierender Weise bedroht,<br />
da Audiokassetten nicht die Tonqualität von Schallplatten erreichen, die Tonqualität einer<br />
Audiokassette aufgr<strong>und</strong> des mechanischen Bandabriebs im Lauf der Zeit stark abnimmt <strong>und</strong><br />
vor allem eine Abgabe für Audiokassetten <strong>und</strong> entsprechende Abspielgräte eingeführt wurde,<br />
so dass eine finanzielle Kompensation der Urheber <strong>und</strong> anderer Rechteinhaber erfolgen kann.<br />
Ab dem Jahr 1982 wandte sich dann das Blatt zunächst weitgehend zugunsten der Phonoindustrie,<br />
als von den Firmen Sony <strong>und</strong> Philips die bis heute für Audioaufzeichnungen übliche Audio<br />
Compact Disc (Audio-CD) eingeführt wurde, die digitale Aufzeichnungen beinhaltet <strong>und</strong> damit<br />
verlustfrei beliebig oft abgespielt werden kann. 20 Da es zu diesem Zeitpunkt nur die analoge<br />
Audiokassette als Medium zur Überspielung von Audio-CDs gab, bestand kein all zu großes<br />
wirtschaftliches Risiko, auch weil der Qualitätsunterschied zwischen beiden Trägermedien signifikant<br />
ist <strong>und</strong> – wie bereits erwähnt – entsprechende Abgaben zu entrichten sind.<br />
Die Phonoindustrie versuchte daher auch in der Folgezeit darauf zu achten, dass jede Kopie<br />
von einer CD – egal auf welches Medium – entweder mit einem Qualitätsverlust behaftet oder<br />
eine digitale Aufnahme gänzlich unmöglich war. Auf letzterem Prinzip beruht z.B. das Serial<br />
Copy Management System (SCMS) aus dem Jahr 1990, welches in jedem digitalen Audio-<br />
Aufnahmegerät implementiert ist <strong>und</strong> steuert, ob digitale Audiodaten nicht, nur einmal oder<br />
beliebig oft auf einen anderen digitalen Datenträger kopiert werden dürfen. 21 Diese Strategie<br />
zur Eindämmung von Raubkopien funktionierte so lange, wie es für den Verbraucher keine<br />
Möglichkeit gab, digitale Daten 1:1 zu kopieren oder auszulesen, da in diesem Fall z.B. auch<br />
die SCMS-Daten einfach mitkopiert, nicht aber ausgewertet werden. 22 Mit der massenhaften<br />
Verbreitung von Heim-PCs <strong>und</strong> darin eingebauten CD-Brennern ab ca. 1998 änderten sich dann<br />
jedoch die „Machtverhältnisse“. Nun konnte <strong>und</strong> kann der Verbraucher Kopien von Audio-CDs<br />
ohne oder ohne merklichen Qualitätsverlust erstellen, indem er die Audiodaten direkt auf einen<br />
so genannten CD-Rohling „brennt“ oder die Audiodaten von der CD ausliest <strong>und</strong> in einen anderes<br />
Datenformat konvertiert sowie wieder auf einem digitalen Datenträger abspeichert. 23 Be-<br />
16. Vgl. http://bnoack.com/history/history-de.html (Stand: 12.8.2002).<br />
17. Vgl. http://bnoack.com/history/history-de.html (Stand: 12.8.2002).<br />
18. Vgl. http://bnoack.com/history/history-de.html (Stand: 12.8.2002).<br />
19. Vgl. http://bnoack.com/history/history-de.html (Stand: 12.8.2002).<br />
20. Vgl. http://bnoack.com/history/history-de.html (Stand: 12.8.2002).<br />
21. Siehe dazu näher Pfitzmann/Federrath/Kuhn, Technischer Teil, S. 38 f.<br />
22. Siehe Pfitzmann/Federrath/Kuhn, Technischer Teil, S. 39.<br />
23. Siehe auch Pfitzmann/Federrath/Kuhn, Technischer Teil, S. 8.<br />
90