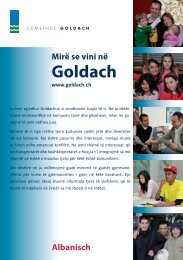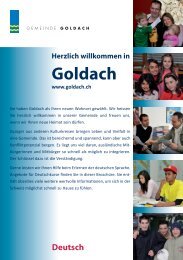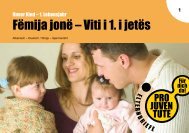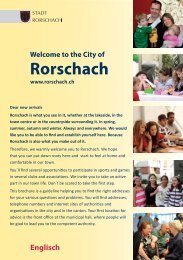MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für die aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
Partizipationsprozesse und -massnahmen auch bei geringen Kosten für MigrantInnen eine finanzielle<br />
Hürde bedeute und dass es hier von Schweizer Seite mehr brauche als nur das zur Verfügung Stellen<br />
von Infrastruktur. Diese beiden Gruppen weisen zudem daraufhin, dass es für eine gelingende<br />
Umsetzung auch personelle Ressourcen benötige, was gerade in kleinen Gemeinden oft nicht<br />
gegeben sei. Dies könne jedoch für den Erfolg oder Misserfolg von Partizipationsprozessen<br />
entscheidend sein. (Diese Meinung teilen auch die telefonisch nachbefragten<br />
GemeindevertreterInnen.)<br />
Die eigenen Aussagen zu ihren Ressourcen beschränken sich bei den älteren MigrantInnen auf<br />
„typisch“ italienische Charaktereigenschaften und Aspekte der italienischen Mentalität (vergleiche<br />
Kapitel 5.3.2.1). Nach Ressourcen im Sinne von Fähigkeiten und Kompetenzen in Bezug auf ihre<br />
Selbstorganisation befragt, zeigt sich, dass sie darüber nicht bewusst reflektiert haben. Somit handelt<br />
es sich eher um ein unbewusstes Potenzial an Ressourcen.<br />
Interpretation: Während die Fokusgruppen und VertreterInnen der Gemeinden soziale Merkmale, die<br />
sie bei der Gruppe der älteren MigrantInnen aus Italien wahrnehmen, als Ressourcen für die Lebens-<br />
gestaltung im Alter interpretieren, fassen die älteren MigrantInnen selber diese in eine essentialisti-<br />
sche Begrifflichkeit von „Nationalkultur“ und nehmen in diesem Sinne eine kollektive und Identität<br />
stiftende Selbstethnisierung vor, in Abgrenzung zu ihrem gesellschaftlichen Umfeld der<br />
Mehrheitsgesellschaft. Diese Selbstethnisierung steht in enger Wechselwirkung zur<br />
Fremdethnisierung durch die VertreterInnen der Schweizer Institutionen/Organisationen, welche zwar<br />
von Ressourcen sprechen, diese aber ebenfalls immer wieder einer mit eigenen Bildern besetzten<br />
„italienischen Mentalität“ oder „Kultur“ zuschreiben (vgl. dazu die Ausführungen zu<br />
Ethnisierungsprozessen in Kapitel 2.2.3).<br />
Ob die gute Selbstorganisation und die familiäre Solidarität die Partizipation am gesellschaftlichen<br />
Umfeld fördere oder nicht, wird ambivalent eingeschätzt, d.h. als Ressource und Schranke zugleich<br />
(vgl. Kapitel 5.2.3 u. 5.2.4).<br />
3 – RAHMENBEDINGUNGEN/STRUKTUREN:<br />
Konsens: MigrantInnen, Fokusgruppe CH, Fokusgruppe IT<br />
Konsens besteht bezüglich der Frage von Partizipation in Form der Ausübung politischer Rechte. Alle<br />
drei Gruppen erachten es als störend und ungerechtfertigt, dass ältere MigrantInnen - mit wenigen<br />
kantonalen und kommunalen Ausnahmen vor allem in der Romandie - immer noch nicht über direkte<br />
demokratische Mitbestimmungsmittel (Stimm- und Wahlrecht) verfügen, es sei denn, sie seien<br />
eingebürgert. Dies, obwohl sie ihr Leben in der Schweiz verbracht, Steuern bezahlt haben und voll im<br />
Arbeitsmarkt integriert waren. Der Weg zur gesellschaftlichen Partizipation müsste demnach<br />
zumindest auf kommunaler Ebene grundsätzlich über politische Rechte führen. Bei den älteren<br />
MigrantInnen habe der lebenslange Ausschluss von diesen Rechten - gemäss ihrer eigenen<br />
Aussagen sowie derjenigen ihrer Organisationen – einen Rückzug von der Mehrheitsgesellschaft und<br />
140