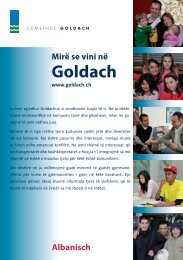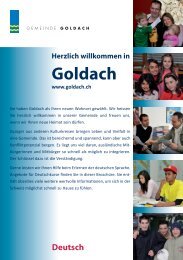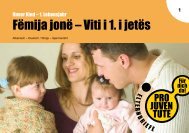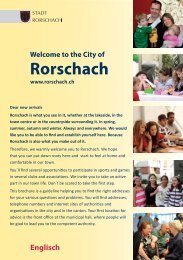MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für die aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
� Kenntnisse über die soziodemografischen Verhältnisse sowie die Lebensbedingungen der<br />
älteren Migrationsbevölkerung in der Gemeinde: Um einen Partizipationsprozess erfolgreich in<br />
die Wege zu leiten, benötigt es zunächst ein differenzierteres Wissen über den<br />
Partizipationspartner. Wer sind die älteren MigrantInnen? Welche Gruppen gibt es nach<br />
Migrationsmotiv, nationaler Herkunft, Schichtzugehörigkeit, Bildung, Geschlecht? Wie<br />
gestalten sie ihr Leben im Alter? Haben sie sich in eigenen Strukturen und Netzwerken<br />
organisiert? Kennen wir diese und ihre Aktivitäten? etc.<br />
� Kritische Reflexion zur Zielgruppendefinition „ältere MigrantInnen“: In der Regel – das haben<br />
auch die Befragungsergebnisse gezeigt – besteht seitens schweizerischer Institutionen und<br />
Fachpersonen der Alterspolitik und –arbeit die Tendenz, „MigrantInnen“ in ethnische<br />
Zielgruppen zu unterteilen, die sie als in sich homogen wahrnehmen. Aus dieser Perspektive<br />
erfolgt dann meist auch die Zusammenarbeit mit MigrantInnen nach ethnischen Kriterien und<br />
derselbe ethnische Hintergrund wird unhinterfragt als das dominante Kriterium für<br />
Repräsentativität herangezogen. (Bsp. ein Italiener steht stellvertretend für „die Italiener“, eine<br />
Tamilin vertritt „die Tamilinnen“, ein Bosnier repräsentiert „die BosnierInnen“etc.) Bei der Wahl<br />
von Einzelpersonen sowie Gruppen von MigrantInnen, die aktiv an Partizipationsprozessen zu<br />
beteiligen sind, ist gleich zu Beginn die kritische Frage nach der Repräsentativität zu stellen.<br />
Es ist auf die innerethnische Heterogenität von MigrantInnengruppen nach Geschlecht,<br />
Bildung, Schichtzugehörigkeit, religiöser oder politischer Überzeugung, etc. zu achten, welche<br />
gleichwertige Repräsentativitätskriterien bilden. Das heisst auch, dass nicht einfach eine<br />
gemeinsame Betroffenheit aufgrund ethnischer Gruppenzugehörigkeit angenommen werden<br />
kann, sondern dass vielmehr bei der „gemeinsamen Themenbetroffenheit als Menschen in der<br />
Lebensphase Alter“ als Ausgangspunkt für gemeinsame Partizipation anzusetzen ist.<br />
� Bewusstsein über und sensibler Umgang mit dem Machtgefälle zwischen staatlichen und<br />
nichtstaatlichen Schweizer AkteurInnen und AkteurInnen der Migrationsbevölkerung: Die<br />
Gemeinden sollten über das Bewusstsein verfügen, dass sie sich gegenüber den<br />
PartizipationspartnerInnen „ältere MigrantInnen“ immer in einer Machtposition befinden. So<br />
verfügen diese über keine politischen Rechte und sind bezüglich ihres Zugangs zu Partizipa-<br />
tionsmöglichkeiten meist vom guten Willen der Schweizer Institutionen/Organisationen und<br />
Fachpersonen abhängig. Mit der dadurch entstehenden Asymmetrie im Partizipations-<br />
verhältnis ist sensibel und transparent umzugehen.<br />
� Sensibilität für Partizipationshürden: Eine Gemeinde, welche die Partizipation von älteren<br />
MigrantInnen im Sinne aktiver Bürgerschaft fördern will, muss zunächst eine Sensibilität für<br />
allfällige Partizipationshürden entwickeln (ökonomisch und gesundheitlich benachteiligte<br />
Situation der Zielgruppe, sprachliche Verständigungsschwierigkeiten, Misstrauen aufgrund<br />
bisherigen Desinteressens der Schweiz für ihre Partizipation oder aber Befürchtung, dass<br />
Partizipation nicht gewollt sei, fehlende politische Rechte, Informationsdefizit über<br />
Partizipationsmöglichkeiten, strukturelle Zugangsschranken zur Partizipation, etc.)<br />
155