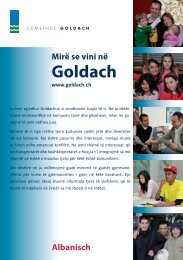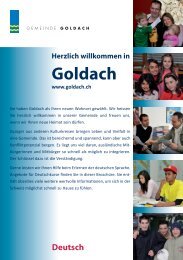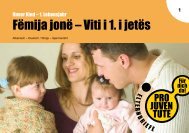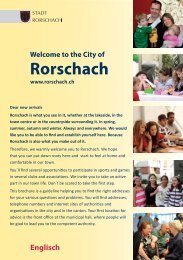MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
Defizite der Zielgruppen, sondern vielmehr ihre Ressourcen und die Stärkungsmöglichkeiten ihres<br />
Handlungspotenzials standen fortan im Fokus des Interessens.<br />
Eine weitere Parallele besteht darin, dass die Themen ‚Alter„ und ‚Migration„ in ihrer Verknüpfung, der<br />
unser Forschungsinteresse gilt, weder in der Migrations- / <strong>Integration</strong>sforschung noch in der<br />
Sozialgerontologie ein etablierter Untersuchungsgegenstand sind. Vielmehr fristet das Thema<br />
‚Migration„ in der Sozialgerontologie und das Thema ‚Alter„ in der Migrations- und<br />
<strong>Integration</strong>sforschung ein stiefmütterliches Dasein. Das Konzept von Alter als Lebensgestaltung<br />
(Kalbermatten 1998), das ‚Alter„ nicht als einen letzten Lebensabschnitt definiert, der keine<br />
Entwicklungsmöglichkeiten mehr bietet, sondern vielmehr von Leben als einem Kontinuumsmodell<br />
ausgeht, das lebenslange Entwicklung (Erikson, 1966) bedeutet, lässt sich auch auf Migration<br />
übertragen. So teilen wir die These von Dietzel-Papakyriakou (1990), dass im Alter immer mehr ein<br />
Rückzug in die eigene ethnische Gruppe geschehe und im interethnischen Kontakt mit der<br />
Mehrheitsgesellschaft keine grossen Entwicklungschancen mehr liegen würden, nur bedingt. Vielmehr<br />
gehen wir davon aus, dass Migration auch eine Ressource für die Lebensgestaltung im Alter ist und<br />
das Alter von MigrantInnen nicht nur vergangenheitsbezogene, sondern in Interaktion mit der<br />
gesellschaftlichen Umgebung auch zukunftsweisende Perspektiven beinhaltet. Wichtig scheint uns im<br />
Weiteren zu überprüfen, ob die Annahme der doppelten Diskriminierung von ethnischen Minderheiten<br />
und Migrationspopulationen im Alter – einerseits aufgrund der Herkunft und anderseits aufgrund der<br />
materiell häufig kritischen Lage – auch für die Schweiz zutrifft. So vertrat u.a. Moore (1971), dass alte<br />
Menschen „zusätzlich zum Altersstigma auch noch Opfer von ethnischen Vorurteilen“ würden. Aber<br />
auch der sechste Berliner Bericht zur Lage der älteren Generation in der Bundesrepublik Deutschland<br />
(2010, S. 94ff) weist darauf hin, dass Alters- und Alternsprobleme von Menschen mit Migrationshinter-<br />
grund ethnogerontologisch häufig mit der „Double-Jeopardy-These“ gefasst werden. Diese besagt,<br />
dass diese Bevölkerungsgruppe von einem doppelten Gefährdungs- oder einem kumulativen<br />
Diskriminierungsrisiko betroffen sei: einerseits von einer ethnisch bedingten und anderseits von einer<br />
altersbezogenen gesellschaftlichen Ausgrenzung (vgl. auch Dowd & Bengtson, 1978).<br />
Solche Benachteiligungen können sich zu einer drei- oder vierfachen ausdehnen, wenn<br />
Altersunterschiede zwischen Männern und Frauen sowie die jeweiligen Schichtzugehörigkeiten<br />
mitgedacht werden. Somit könne geradezu von einem „grey triangle of structural ageism“ gesprochen<br />
werden. Am meisten benachteiligt in unserer Gesellschaft seien demnach Frauen mit nichtwestlichen<br />
Migrationshintergründen, die aus unteren sozialen Schichten stammen. Aber gerade für diese Gruppe<br />
würden die Orientierung an einem ethnischen Selbstverständnis sowie insbesondere religiöse<br />
Einstellungen und Organisationen einen wichtigen Halt und Schutz im Alter bieten. Die Ethno-<br />
Gerontologie versteht Ethnizität und Religiosität als Ressourcen, auf die gerade im Alter<br />
zurückgegriffen wird (vgl. Kondratowitz, 1999). Das Interesse an herkunftsbezogenen Erinnerungen<br />
nimmt zu, ebenso an der eigenen kulturellen und religiösen Identität, die allerdings nicht statisch ist,<br />
sondern immer wieder in Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Umgebungseinflüssen<br />
gedeutet und neu konstruiert wird. Ethnizität, Religiosität und soziokulturelle Herkunftsbezüge<br />
gewinnen somit im Alter zunehmend an Bedeutung. Sie seien aber niemals als gegebene oder gar<br />
34