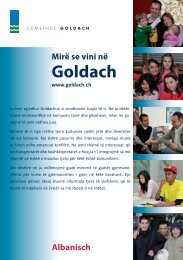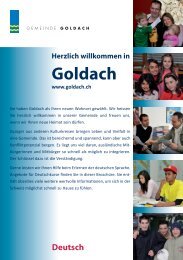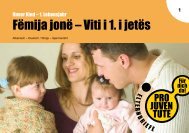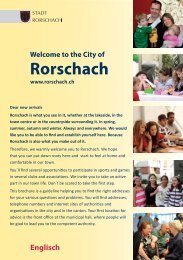MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für die aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
tendenziell zu Scheinkorrelationen geführt hätte. Korrelationen wären in diesem Zusammenhang<br />
auch nur dann interessant gewesen, wenn sich Kausalitäten hätten aufzeigen lassen.<br />
� Ungeprüfte Annahme: Folgende in Kapitel 3 getroffene Annahme wurde nicht konkret überprüft:<br />
„Ältere MigrantInnen müssen aufgrund ihres Alters und ihres Migrationshintergrunds mit einem<br />
doppelten Benachteiligungs- oder gar Diskriminierungsrisiko rechnen.“ Jedoch auch ohne<br />
Überprüfung der Annahme gelangen die Autorinnen zu folgendem Schluss: Dass ältere<br />
MigrantInnen als „Fremde“ wahrgenommen und als solche auch immer wieder gesellschaftlich<br />
ausgeschlossen werden, hat nicht eigentlich mit ihrer Ethnizität zu tun. Es ist vielmehr das<br />
Resultat eines Zirkelschlusses. Die „Schweizer“ haben die MigrantInnen als Fremde behandelt<br />
und nicht als gleichwertigen Teil der Zivilgesellschaft partizipieren lassen. Dieser Ausschluss hat<br />
zum Rückzug der MigrantInnen in die eigenen Strukturen und Organisationen geführt, was bei der<br />
Schweizer Bevölkerung dann zur Schlussfolgerung führte, dass ihre Annahme eines<br />
Desinteresses für die Teilnahme an der Schweizer Zivilgesellschaft korrekt war. Dies wiederum<br />
hatte zur Folge, dass bis heute davon ausgegangen wird, dass die MigrantInnen eben auch im<br />
Alter nicht interessiert seien. Es ist also nicht die Kombination Alter und Migrationshintergrund, die<br />
in erster Linie zur Benachteiligung führt, sondern diese ist auf die beschriebenen Annahmen und<br />
Reaktionen zurückzuführen.<br />
Zum Modell <strong>MIGRALTO</strong><br />
� Unspezifität des Modells: Die Autorinnen sind sich bewusst, dass man das Modell <strong>MIGRALTO</strong> als<br />
ein zu allgemein gehaltenes Modell kritisieren kann, das zu wenig altersspezifisch ausgerichtet<br />
sei. Sie stimmen zu, dass das Modell mit seinen Strukturebenen als generelles Partizipations-<br />
modell gelten kann. Dies lässt sich aber in zweifacher Hinsicht als seine Stärke interpretieren: Das<br />
Modell kann durch seine allgemeine Grundstruktur für unterschiedliche Projekte zum Thema<br />
Partizipation angewendet werden und ermöglicht dadurch eine zielgruppenunspezifische<br />
Multiplizierbarkeit. Der zweite Punkt betrifft die ethnien-unspezifische Anwendbarkeit. Das Modell<br />
selbst hat eine – man könnte sagen - neutrale Grundstruktur. Es erlaubt aber, sich innerhalb der<br />
einzelnen Felder (vergleiche Kapitel 6.3.3) flexibel an ethnien-, gender, schicht- , bildungs- oder<br />
kohortenspezifische Eigenheiten und Bedürfnisse anzupassen.<br />
� Generationenbeschränkung: Die Autorinnen sind der Ansicht, dass das Modell jeweils nur auf die<br />
erste Generation einer ethnischen Gruppe angewendet werden kann.<br />
Die zweite Generation gilt in der Regel als gut integriert und hat auch ohne politische Rechte<br />
Möglichkeiten zur aktiven Bürgerschaft, die sie nach Bedarf und Interesse wahrnehmen kann.<br />
Ausserdem kennt sie die Regelstrukturen in der Schweiz und hat somit generell leichteren Zugang<br />
zu Informationen oder Dienstleistungen im Zusammenhang mit Partizipation.<br />
Demgegenüber sind MigrantInnen der ersten Einwanderungsgeneration häufig „Fremde“ im<br />
Aufnahmeland geblieben, in welchem sie zwar - im Falle ihres Verbleibens - alt werden, aber<br />
eigentlich auch im Alter „Ausgeschlossene“ sind. Dies weist auf den bereits diskutierten<br />
179