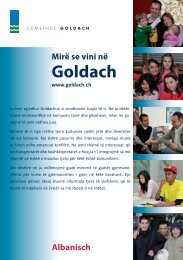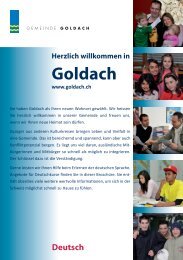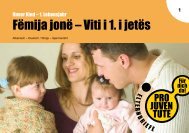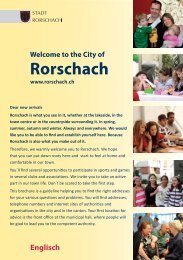MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
Konzept des „Aktiven Alterns“ versteht Naegele (2008) unter sozialer und politischer Partizipation im<br />
Alter in erster Linie das aktive zivilgesellschaftliche oder zivilbürgerschaftliche Engagement mit dem<br />
Ziel der Einflussnahme älterer Menschen auf den öffentlichen Raum und dessen Mitgestaltung, und<br />
zwar im Sinne von Mitwirkung bei der Lösung von lebensweltlichen Problemen und Anliegen aller<br />
Altersgruppen (inklusive derjenigen der älteren Menschen selbst).<br />
2.6.2 Partizipation älterer MigrantInnen (H. Hungerbühler)<br />
Während die Gerontologie sich also für dieses neue Alternsbild und für die Partizipation älterer<br />
Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen stark macht (Kruse, u.a., 2010; 2005), ist dieser<br />
Diskurs bisher mehrheitlich ohne Blick auf die alternde Migrationsbevölkerung geführt worden. Auf<br />
diese soll jedoch im Folgenden der Fokus gerichtet werden.<br />
Bachl (2004, S. 15) vertritt die Ansicht: „Würde man ältere Migranten in die Alterspolitik und<br />
Zukunftsgestaltung einbeziehen, würden sie vom „Problem“ und von einer „Belastung“ zu<br />
Mitwirkenden, die Lösungen finden und selbst realisieren.“ Diese Annahme unterstützen die<br />
Autorinnen und verstehen unter Partizipation die gleichberechtigte Teilhabe am gesellschaftlichen<br />
Leben und seiner Entwicklung in all seinen Phasen, so auch im Alter. Gamboa (2009, S. 176) kritisiert<br />
am aktuellen <strong>Integration</strong>sdiskurs in der Schweiz unter seinem neuen Paradigma des „Förderns und<br />
Forderns“, dass in Partizipationsprozessen zwischen schweizerischen Institutionen und Fachpersonen<br />
einerseits und MigrantInnen anderseits eine hierarchische „Arbeitsteilung“ zu beobachten sei:<br />
„Konzeptarbeit und Entscheidungen fallen in den Aufgabenbereich der von den Institutionen<br />
ernannten <strong>Integration</strong>sexpertinnen und -experten, deren Arbeit dementsprechend entlöhnt und<br />
anerkannt wird. Die konkrete Arbeit an der Basis wird meist den Migrantinnen und Migranten<br />
überlassen, denen in dieser Form von <strong>Integration</strong>sprogrammen und –projekten hauptsächlich Rollen<br />
als Schlüsselpersonen für ihre Communities bzw. als so genannte Kulturvermittlerinnen und -vermittler<br />
zugewiesen werden.“ In den Aufgabenbereich der Letzteren gehören dann in der Regel Arbeiten wie<br />
Übersetzen oder andere eher ausführende Tätigkeiten, die gekennzeichnet seien durch weitgehend<br />
fehlende oder nur wenig Entscheidbefugnis, keinen oder nur tiefen Lohn sowie ein geringeres<br />
Prestige. In Bezug auf die Zielgruppen von <strong>Integration</strong>smassnahmen lasse sich Ähnliches feststellen.<br />
So seien diese meist einseitig an die Adresse der Zugewanderten gerichtet. Im Diskurs, der den<br />
aktuellen Ansatz des „Förderns und Forderns“ begleitet, wie er sich nun immer mehr auch in<br />
kantonalen Gesetzgebungen niederschlägt, würde die Analyse struktureller <strong>Integration</strong>shindernisse<br />
und Diskriminierungsmechanismen ausgelassen. Dadurch werden für den Erfolg oder Misserfolg von<br />
<strong>Integration</strong> einseitig die Migrantinnen verantwortlich gemacht, welche somit einer defizitorientierten<br />
Wahrnehmung seitens der Gesellschaft ausgesetzt sind.<br />
Prodolliet (2009, S. 59) führt diese Kritik mit ihrer Forderung, dass Zielgruppen der <strong>Integration</strong>spolitik<br />
eigentlich neu zu denken seien, konsequent weiter. Sie vertritt die Ansicht, eine <strong>Integration</strong>spolitik, die<br />
– wie neu im Ausländergesetz AuG (2008) verankert – zum Ziel habe, „das friedliche Zusammenleben<br />
aller auf der Grundlage der Werte der Bundesverfassung und der gegenseitigen Achtung und<br />
Toleranz“ zu fördern, nicht einseitig nur auf eine Bevölkerungsgruppe auszurichten sei. Vielmehr<br />
32