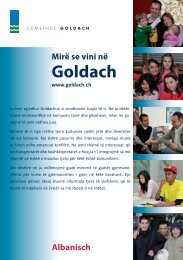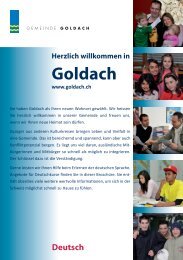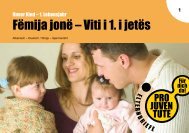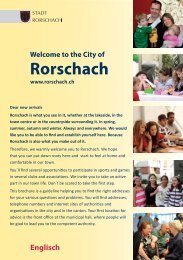MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
MIGRALTO - Integration
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
«<strong>MIGRALTO</strong> – Partizipatives Modell für aktive Bürgerschaft von älteren MigrantInnen»<br />
Der zentrale Punkt für diese Forschung ist die Feststellung, dass die Lernerfahrungen der primären<br />
Sozialisationsphase als gefestigt und nicht mehr veränderbar gelten. Das Erlernte der sekundären<br />
(und tertiären) Phase hingegen bleibt veränderbar, der Mensch bleibe also in der Lage auch neue<br />
Rollen anzunehmen und wird vom sozialen Kontext weiterhin beeinflusst.<br />
An dieser Stelle wird auch auf das Konzept der sozial-kognitiven Lerntheorie nach Bandura (in: Abels<br />
und König, 2006) hingewiesen, wonach Lernen stets ein sozialer Vermittlungsprozess ist. Nach den<br />
Lerntheorien würde die Persönlichkeitsentwicklung im Grundsatz dem Aufbau von Lernerfahrungen<br />
gleichgesetzt. Unter dem Begriff Motivationsprozesse innerhalb der Lerntheorie Bandura‟s, hat bereits<br />
die blosse Erwartung von Konsequenzen eine verhaltenssteuernde Wirkung, was bedeutet, dass die<br />
gedankliche Vorwegnahme von Konsequenzen motivierend oder demotivierend wirken kann.<br />
Die Autorinnen gehen aufgrund der vorgestellten Sozialisationskonzepte davon aus, dass Ethnizität<br />
ein mitbestimmender Faktor ist für eine aktive Bürgerschaft im Alter, nicht aber der prägende. Da<br />
Sozialisation als lebenslanger Prozess gesehen wird, der als soziales Lernen interpretiert wird,<br />
bedeutet das, dass ältere MigrantInnen durch ihren jahre- oder jahrzehntelangen Aufenthalt im<br />
Aufnahmeland vielseitige Erfahrungen erworben haben im Sinne der Sekundär- und Tertiär-<br />
sozialisation, dass sie ohnehin nicht mehr einfach eine oder diese spezifische Ethnizität verkörpern.<br />
Im Weiteren ist das Modell <strong>MIGRALTO</strong> ein prospektives Projekt, das von einer Ausgangssituation<br />
ausgeht (Biografie der älteren MigrantInnen), das aber als Ziel vor allem auch Kompetenz-Erwerb<br />
anstrebt und somit Teil einer weiteren Sozialisierung im Sinne eines sozialen Lernens.<br />
In Zusammenhang mit den neueren gerontologischen Konzepten zur Lernfähigkeit im Alter<br />
(Stadelhofer, 1996) liesse sich – allerdings hier ungeprüft – sagen, dass sekundäre und tertiäre<br />
Sozialisation sowie sozial-kognitives Lernen altersunspezifische Konzepte sind. Welche Implikationen<br />
diese Feststellung für Partizipationsprozesse mit älteren MigrantInnen hat, wird aufgrund der<br />
Ergebnisse aus den Analysen und aus dem Erkenntnisgewinn (vergleiche Kapitel 6.2,<br />
Schlussfolgerungen) diskutiert.<br />
2.3 MigrantInnen als Teil der Altersbevölkerung(H. Hungerbühler)<br />
Dieses Kapitel liefert einen Überblick zur Definition „Ältere MigrantInnen“ (2.3.1), zu den statistischen<br />
Angaben und Fakten zur älteren Migrationsbevölkerung in der Schweiz mit Fokus auf den<br />
ItalienerInnen (2.3.2) sowie zum Forschungsstand (2.3.3).<br />
2.3.1 Definition ältere MigrantInnen<br />
In der vorliegenden Masterarbeit verstehen die Autorinnen unter der „älteren Migrationsbevölkerung“<br />
bzw. unter „älteren Migrantinnen und Migranten“ alle Menschen mit Migrationshintergrund, die im<br />
Rentenalter stehen (ab 62 bzw. 65 Jahren). Obwohl die Datenlage zeigt, dass MigrantInnen häufig<br />
aufgrund belastender Arbeitsbedingungen im Niedriglohnbereich gesundheitlich früher altern (Weiss,<br />
2003; Dietzel-Papakyriakou, 1993), nehmen wir das Pensionierungsalter als Indikator. Für<br />
16