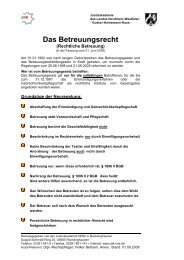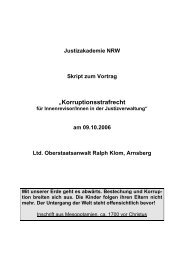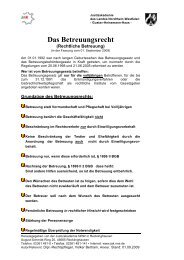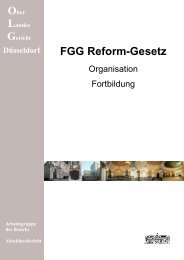Arbeitshilfe - Justizakademie Nordrhein-Westfalen
Arbeitshilfe - Justizakademie Nordrhein-Westfalen
Arbeitshilfe - Justizakademie Nordrhein-Westfalen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Teil I Materielles Recht der Vermögensabschöpfung<br />
Lösung Fall 2<br />
Die Anordnung des LG war an diesen Maßstäben gemessen rechtsfehlerhaft. Der Angeklagte<br />
hat vielmehr den Gesamterlös von 161.000,- EUR erlangt. Dieser Betrag befand<br />
sich zumindest kurzfristig in der Verfügungsgewalt des Angeklagten. Auf die zivilrechtlichen<br />
Eigentums- und Besitzverhältnisse zwischen den Beteiligten kommt es<br />
dabei nicht an. Aufwendungen sind wegen des Bruttoprinzips nicht abzugsfähig. Damit<br />
könnte lediglich über § 73c StGB eine Korrektur dieser Lösung erfolgen.<br />
Frage:<br />
Erläutern Sie die Unterschiede zwischen Unmittelbarkeit und Bruttoprinzip.<br />
Unmittelbarkeit und Bruttoprinzip sind streng voneinander zu trennen. In einem ersten Prüfungsschritt<br />
ist festzustellen, worin genau der Vorteil besteht, wofür das Bruttoprinzip nicht herangezogen<br />
werden kann. Die Bestimmung des Vorteils ist nämlich der Bestimmung seines Umfangs als zweiter<br />
Prüfungsschritt (und hier gilt das Bruttoprinzip) logisch vorgelagert 40 .<br />
Anders ausgedrückt: Das Bruttoprinzip bezieht sich nur auf Kosten, die in Zusammenhang der rechtswidrigen<br />
Vorteilserlangung stehen, und nicht auf Abzugsposten, die dem Erlangten selbst immanent<br />
sind und seinen Wert bestimmen, oder auf Vorteile, die in rechtlich nicht zu beanstandender Weise<br />
erzielt wurden 41 . Dieses Abgrenzungsproblem ist ein „Dauerbrenner“ und hat in den letzten Jahren zu<br />
ungewöhnlich heftigen Kontroversen geführt, denen letztlich zugrunde liegt, ob normativ gebotene<br />
Beschränkungen des Erlangten schon auf tatbestandlicher Ebene oder erst im Rahmen der Härtefallprüfung<br />
vorzunehmen sind 42 . Dies zeigt sich insbesondere im Wirtschaftsstrafrecht bei die Bestimmung<br />
des (unmittelbar) Erlangten erschwerenden mehraktigen Geschehensabläufen.<br />
(aa) BtM-Fälle<br />
Der Anwendungsbereich des Verfalls erfährt durch das ungeschriebene Tatbestandsmerkmal<br />
der Unmittelbarkeit eine weitere Einschränkung.<br />
Der BGH hat dieses Merkmal über einen Vergleich der Absätze 1 und 2 des § 73 StGB<br />
hergeleitet.<br />
Während sich § 73 Abs. 1 StGB auf das eigentliche „Etwas“, das der Täter aus der Tat<br />
erlangt hat, bezieht, erweitert § 73 Abs. 2 StGB den Anwendungsbereich des Verfalls<br />
auf mittelbare Tatvorteile, namentlich auf Nutzungen und Surrogate, weshalb im Umkehrschluss<br />
die unmittelbaren Vermögenszuwächse nur von § 73 Abs. 1 StGB erfasst<br />
werden 39 .<br />
Von daher dürfte eine in Anlehnung an die ober- und höchstrichterliche Rechtsprechung<br />
mehr kasuistische Betrachtungsweise angezeigt sein, sich der Gesamtproblematik<br />
zu nähern.<br />
Beim Verkauf von Drogen ist der gesamte Erlös ohne Abzug von Einkaufspreis, Transportkosten,<br />
Kurierlohn usw. für verfallen zu erklären 43 .<br />
39<br />
BGH, Urteil vom 21.03.2002, 5 StR 138/01; vgl. auch BVerfG, Beschluss vom 07.07.2006, 2 BvR 527/06.<br />
40<br />
BGH, a.a.O.<br />
41<br />
Wiedner, Graf/Jäger/Wittig, Wirtschafts- und Steuerstrafrecht, 2011, § 73 StGB Rn. 25.<br />
42<br />
Vgl. hierzu auch BGH, Urteil vom 19.01.2012, 3 StR 343/11 Rn. 20.<br />
43<br />
BGH, Urteil vom 05.04.2000, 2 StR 500/99 (Ständige Rspr.).<br />
19