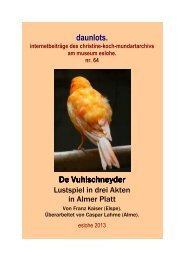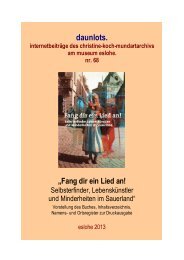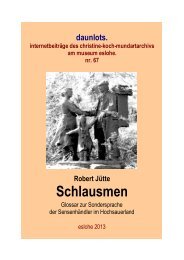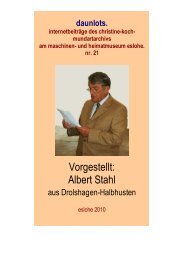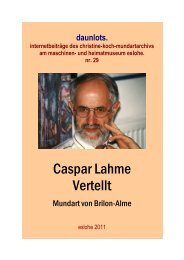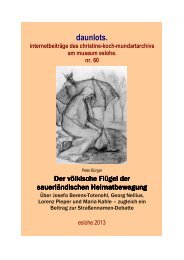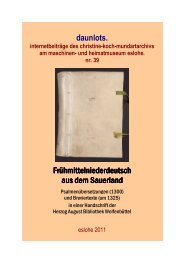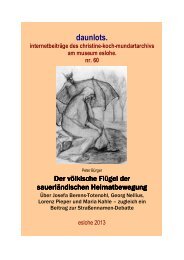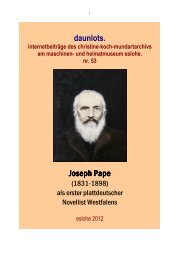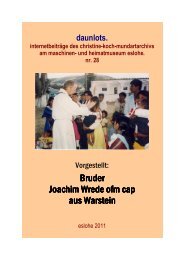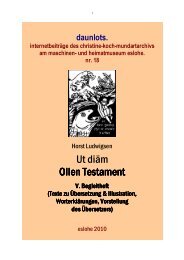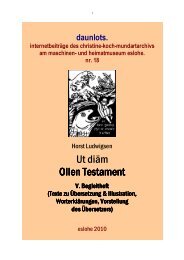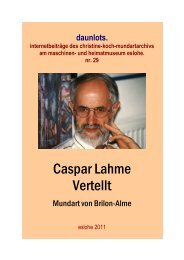Texte - Sauerlandmundart
Texte - Sauerlandmundart
Texte - Sauerlandmundart
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Dorfleben im Drolshagener Land<br />
► Nachwort<br />
Wer meint, Zoten und sexuelle An- Aber wird in Platt Abber ausgesprozüglichkeiten<br />
gehörten im Niederdeutchen.schen zum Normalen, der offenbart nur Wörtchen wie koom, sooch, goov<br />
seine eigene Wunschvorstellung. Er in- schreibe ich mit doppeltem Vokal, daterpretiert<br />
etwas hinein, das er gerne mit die Dehnung beim Sprechen nicht<br />
annimmt, weil er es so sehen will. übersehen wird.<br />
Das Wörtchen „an“ schreibe ich<br />
Zum Aufbau der Arbeit:<br />
einmal mit a, einmal mit aa: An der Giëbbelsiete<br />
streïk hei de Pöste aan.<br />
Die vielen Geschichten sind in der<br />
Mehrzahl als abgeschlossene Einzeldarstellungen,<br />
etwa für die Plattdeutsche<br />
Runde, entstanden.<br />
So sind bestimmte Ereignisse mehrfach<br />
– jeweils in einer separaten Geschichte<br />
– erzählt. Diese kann man aber<br />
nicht leicht herausnehmen oder kürzen,<br />
da sie für das jeweilige Thema wichtig<br />
sind. –<br />
So erscheint „Kriegsweihnacht“ etwa<br />
in der Abhandlung von Weihnachten<br />
und im Bericht über den Krieg.<br />
Zum „Radfahren“ gibt es Aussagen<br />
in den <strong>Texte</strong>n über Schulwege und über<br />
Krieg.<br />
Vom „Hitlergruß“ wird berichtet bei<br />
Aussagen zum Krieg und zur Schulzeit.<br />
Zur Rechtschreibung:<br />
Die Schreibweise des Niederdeutschen<br />
ist nicht festgelegt, darum nicht<br />
bedrängend.<br />
Bei meinen <strong>Texte</strong>n richte ich mich<br />
sehr stark nach dem Gehör, gleiche die<br />
Lautung daneben dem Hochdeutschen<br />
an.<br />
So setze ich durchweg ein B statt eines<br />
möglichen W, so etwa in dem<br />
Wörtchen aber, das ich dann jedoch mit<br />
zwei B schreibe. Das hochdeutsche<br />
168<br />
Um anzuzeigen, dass die Vokale e<br />
und i nicht immer zu einem ei oder zu<br />
einem ie verschmolzen werden, habe<br />
ich bei Bedarf Trennpunkte über diese<br />
Buchstaben gesetzt. So lautet das<br />
hochdeutsche schief in Platt nicht<br />
scheif wie in Schweif, sondern scheïf,<br />
also e und i für sich gesprochen.<br />
Das gilt auch für das ie: man spricht<br />
es meist nicht als ein langes i wie in<br />
Schiefer, sondern Schiëbber.<br />
Zu den Illustrationen:<br />
Wesentlicher Bestandteil meiner Arbeit<br />
sind die zur Klärung eines Sachverhalts<br />
eingefügten Bilder. Mehrere<br />
Photos seit 1950 entstanden mit eigenen<br />
Kameras oder stammen aus Familienbesitz.<br />
Andere aus der früheren Zeit<br />
hat Herbert Schulte gesammelt.<br />
Felix Stahlhacke war mir behilflich<br />
wie auch die Archive der Städte Attendorn,<br />
Olpe und Hilchenbach. Geradezu<br />
in letzter Minute konnte ich auf die<br />
Sammlung der Ortschaft Iseringhausen<br />
zurückgreifen.<br />
Besonderer Dank aber kommt wiederum<br />
Willi Schmidt zu, der nach gezielt<br />
erfragten Bildern stundenlang in<br />
seinem Fundus gesucht oder diese erst<br />
noch aufgenommen hat.