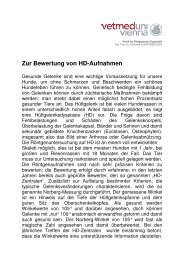Aus dem Klinischen Department für diagnostische ... - Vet-roentgen.at
Aus dem Klinischen Department für diagnostische ... - Vet-roentgen.at
Aus dem Klinischen Department für diagnostische ... - Vet-roentgen.at
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
123<br />
menschlichen Augen eine horizontale Distanz von ca. 6,5 cm (Stereobasis)<br />
voneinander haben müssen. Bei Betrachtung durch ein Prisma werden die zwei<br />
Einzelbilder zur Deckung gebracht und die abgebildeten Objekte erscheinen<br />
körperlich. Besonders wichtig bei derartigen Aufnahmen ist es, zwei Bilder desselben<br />
Objekts so anzufertigen, dass bei der zweiten Aufnahme keine weitere Verschiebung<br />
zusätzlich zur Stereobasis auftritt. Außer<strong>dem</strong> muss darauf geachtet werden, dass die<br />
Aufnahmebedingungen <strong>für</strong> beide Aufnahmen gleich sind, d. h. der P<strong>at</strong>ient darf seine<br />
Lage nicht verändern und die Röntgenstrahlen müssen beide Male von gleicher<br />
Qualität sein (BIENEK, 1994).<br />
Diese Voraussetzungen waren allerdings in den ersten Jahrzehnten der<br />
Röntgenologie infolge der technischen Unzulänglichkeiten der Induktoren und der<br />
Instabilität der Ionenröhren nur sehr schwer zu erfüllen.<br />
Eine andere, leichter durchführbare Methode bestand darin, „Röntgenogramme“<br />
herzustellen, „die aus zwei auf derselben photographischen Pl<strong>at</strong>te befindlichen<br />
Abbildungen desselben Objektes bestehen“. Dazu wurde eine Stereoröhre<br />
(siehe Abb. 114) benutzt, die 1901 von der Firma Reiniger, Gebbert & Schall<br />
entwickelt worden war. Sie besaß zwei mit <strong>dem</strong> neg<strong>at</strong>iven Pol des Induktors<br />
verbundene K<strong>at</strong>hoden und eine Doppelantik<strong>at</strong>hode mit zwei in einem gegenseitigen<br />
Abstand von 6,5 cm angebrachten Pl<strong>at</strong>inspiegel; „ jeder dieser Spiegel steht einer<br />
der beiden ... K<strong>at</strong>hoden gegenüber und sendet ... beim Betriebe der Röhre<br />
Röntgenstrahlen aus. Die beiden aus der Stereoröhre austretenden Strahlenbündel<br />
erzeugen jedes <strong>für</strong> sich ein Bild des Objektes, sodaß eine Röntgenaufnahme<br />
resultiert, welche alle Konturen und Sch<strong>at</strong>ten doppelt aufweist“ (ALBERS -<br />
SCHÖNBERG, 1910).<br />
Zur <strong>Aus</strong>wertung der stereoskopischen Röntgenbilder benutzte man z.B. einen<br />
Stereoplanigraphen: auf einer optischen Bank waren zwei einander<br />
gegenüberstehende, gegeneinander verstellbare und elektrisch beleuchtbare<br />
Schaukästen mit Einsätzen <strong>für</strong> die Röntgenpl<strong>at</strong>ten aufgestellt. In der Mitte zwischen<br />
den Kästen befand sich ein Whe<strong>at</strong>stonesches Stereoskop mit durchsichtigen<br />
Spiegelflächen, das durch Lichtpunkte eine genaue Einstellung der Kästen<br />
zueinander und zum Betrachter ermöglichte (BIENEK, 1994).