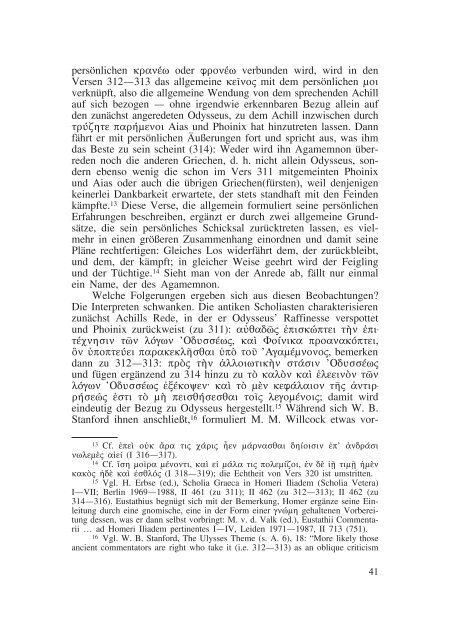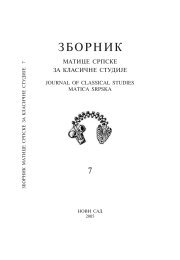Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
persönlichen krançw oder cronçw verbunden wird, wird in den<br />
Versen 312—313 das allgemeine keìnoj mit dem persönlichen moi<br />
verknüpft, also die allgemeine Wendung von dem sprechenden Achill<br />
auf sich bezogen — ohne irgendwie erkennbaren Bezug allein auf<br />
den zunächst angeredeten Odysseus, zu dem Achill inzwischen durch<br />
trÿzhte par0menoi Aias und Phoinix hat hinzutreten lassen. Dann<br />
fährt er mit persönlichen Äußerungen fort und spricht aus, was ihm<br />
das Beste zu sein scheint (314): Weder wird ihn Agamemnon überreden<br />
noch die anderen Griechen, d. h. nicht allein Odysseus, sondern<br />
ebenso wenig die schon im Vers 311 mitgemeinten Phoinix<br />
und Aias oder auch die übrigen Griechen(fürsten), weil denjenigen<br />
keinerlei Dankbarkeit erwartete, der stets standhaft mit den Feinden<br />
kämpfte. 13 Diese Verse, die allgemein formuliert seine persönlichen<br />
Erfahrungen beschreiben, ergänzt er durch zwei allgemeine Grundsätze,<br />
die sein persönliches Schicksal zurücktreten lassen, es vielmehr<br />
in einen größeren Zusammenhang einordnen und damit seine<br />
Pläne rechtfertigen: Gleiches Los widerfährt dem, der zurückbleibt,<br />
und dem, der kämpft; in gleicher Weise geehrt wird der Feigling<br />
und der Tüchtige. 14 Sieht man von der Anrede ab, fällt nur einmal<br />
ein Name, der des Agamemnon.<br />
Welche Folgerungen ergeben sich aus diesen Beobachtungen?<br />
Die Interpreten schwanken. Die antiken Scholiasten charakterisieren<br />
zunächst Achills Rede, in der er Odysseus' Raffinesse verspottet<br />
und Phoinix zurückweist (zu 311): aœuad%j ñpisk3ptei t§n ñpitçxnhsin<br />
t%n lÃgwn 'Odyssçwj, kaÆ Coånika proanakÃptei,<br />
Õn Œpopteÿei parakeklésuai ŒpÁ to‡ 'Agamçmnonoj, bemerken<br />
dann zu 312—313: prÁj t§n Èlloiwtik§n stÀsin 'Odyssçwj<br />
und fügen ergänzend zu 314 hinzu zu tÁ kalÁn kaÆ ñleeinÁn t%n<br />
lÃgwn 'Odyssçwj ñqçkofenÞ kaÆ tÁ mÇn kecÀlaion téj Èntirr0se3j<br />
Ñsti tÁ m§ peisu0sesuai toìj legomçnoij; damit wird<br />
eindeutig der Bezug zu Odysseus hergestellt. 15 Während sich W. B.<br />
Stanford ihnen anschließt, 16 formuliert M. M. Willcock etwas vor-<br />
13 Cf. ñpeÆ oœk Ëra tij xÀrij óen mÀrnasuai dhåoisin ñp' ÈndrÀsi<br />
nwlemÇj aøeå (I 316—317).<br />
14 Cf. Äsh moìra mçnonti, kaÆ eø mÀla tij polemåzoi, ñn dÇ øü timü âmÇn<br />
kakÁj âdÇ kaÆ ñsulÃj (I 318—319); die Echtheit von Vers 320 ist umstritten.<br />
15 Vgl. H. Erbse (ed.), Scholia Graeca in Homeri Iliadem (Scholia Vetera)<br />
I—VII; Berlin 1969—1988, II 461 (zu 311); II 462 (zu 312—313); II 462 (zu<br />
314—316). Eustathius begnügt sich mit der Bemerkung, Homer ergänze seine Einleitung<br />
durch eine gnomische, eine in der Form einer gn3mh gehaltenen Vorbereitung<br />
dessen, was er dann selbst vorbringt: M. v. d. Valk (ed.), Eustathii Commentarii<br />
… ad Homeri Iliadem pertinentes I—IV, Leiden 1971—1987, II 713 (751).<br />
16 Vgl. W. B. Stanford, The Ulysses Theme (s. A. 6), 18: “More likely those<br />
ancient commentators are right who take it (i.e. 312—313) as an oblique criticism<br />
41