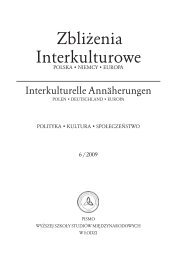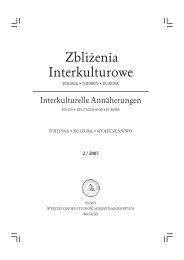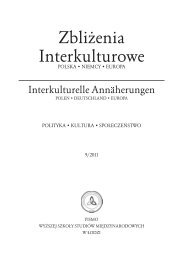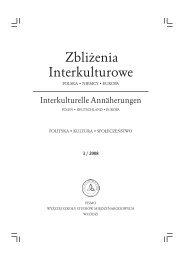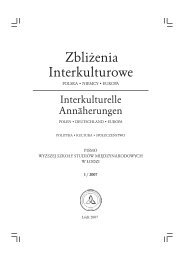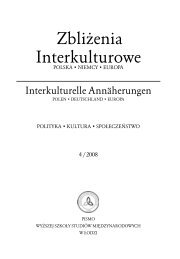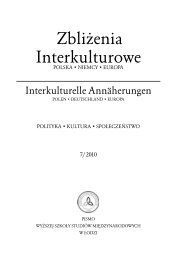zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Recenzje<br />
künstleri schem Wert und sensationell nur<br />
für eine transatlantische Pres se, die davon<br />
im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts<br />
Kenntnis nimmt.<br />
Dass Hans Fallada so entlarvende Porträts<br />
von Tätern und Mitläu fern des braunen<br />
Regimes zeichnen konnte, verdankt er<br />
Erfahrun gen und erst im Laufe der Jahre<br />
gewonnenen Einsichten, die in den Wochen,<br />
die er in der Landesanstalt Altstrelitz<br />
machen konn te, in die er „nach Auseinandersetzung<br />
mit einer Schusswaff e“ im<br />
Streit mit seiner geschiedenen Frau über<br />
sich ergehen lassen muss te. Hier schrieb er<br />
1944 heimlich an seinen Erinnerungen an<br />
die Jahre nach 1933, als Fallada zwar ein<br />
„unerwünschter Autor“ war, aber seine Zeit<br />
brauchte, bis er begriff , mit wem er sich<br />
notgedrungen einließ, um weiter publizieren<br />
zu können.<br />
Dieses wichtige Dokument hat der Aufbau<br />
Verlag unter dem Titel „In meinem<br />
fremden Lande“ als „Gefängnistagebuch<br />
1940“ schon 2009 seinen Lesern zum Geschenk<br />
gemacht, obwohl in diesem Fall zuerst<br />
den beiden Herausbringerinnen Jenny<br />
Williams und Sabine Lange gedankt werden<br />
muss, denen es gelang, den winzig kleinen<br />
handschriftlichen Text wie eine Keilschrift<br />
zu entziff ern und zu kommentieren.<br />
Um ein „Gefängnistagebuch“ handelt<br />
es sich im strengen Sinne aber nur dann,<br />
wenn der Schreiber ein „Sonderblatt“ einlegt<br />
und darüber berichtet, wo, wie und<br />
unter welcher Gefahr er seine zum Hass gesteigerten<br />
Aversionen den Nazis gegenüber<br />
zu Papier bringt. In den weitaus umfangreicheren<br />
Teilen dieses Buches steht geschrieben,<br />
wie Fallada die Wohnorte wechselnd<br />
sich schließlich in Feldberg ein Zuhause<br />
schaff te, aber auch dort nicht umhin kam,<br />
auf Vertreter des Regimes zu treff en, die<br />
ihm das Leben schwer machen. Doch auch<br />
von denen, die mit ihm be freun det waren,<br />
wie sein Verleger Ernst Rowohlt, ihm zu<br />
Seite standen wie Peter Suhrkamp und der<br />
ihm nicht geheure Ernst von Salomon werden<br />
von Fallada porträtiert, so wie die beiden<br />
in den NS-Kulturbetrieb involvierten<br />
Filmschauspieler Emil Jannings und Mathias<br />
Wiemann, die Fallada damals kennen<br />
lernte, erscheinen in dieser Porträtgalerie.<br />
Und auch der im Zwielicht von Distanz<br />
und Anpassung gezeigte Zeichner Erich<br />
Ohser, der 1944 bei der Gesta po landete,<br />
fehlt nicht. Schließlich, Fallada selbst,<br />
anfangs ebenfalls nicht frei von antijüdischem<br />
Ressentiment, und seine Frau Anna<br />
Ditzen (das „Lämmchen“ aus dem Roman<br />
„Kleiner Mann – was nun?“) geben Einblicke<br />
in „Szenen einer Ehe“, die 1944 zu<br />
Ende ging.<br />
So gesehen ergänzen sich Gefängnistagebuch<br />
und Roman in aufhel len der Weise,<br />
denn die Notizen in der Gefangenschaft<br />
lassen sich auch als Prüfstein und Wegmesser<br />
zur Hand nehmen, um Falladas eigenen<br />
Lernprozess vom Herbst 1944 bis zum<br />
Herbst 1946 zu ver mes sen, als das Vorwort<br />
zum Roman geschrieben wurde, an dessen<br />
Ende es heißt:<br />
Es hat dem Verfasser auch oft nicht gefallen,<br />
ein so düsteres<br />
Gemälde zu entwerfen, aber mehr Helligkeit<br />
hätte Lüge bedeutet.<br />
Wie wahr! Und zweifacher Dank dem<br />
Verlag!