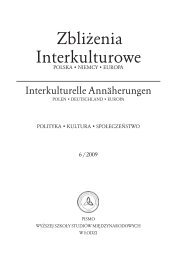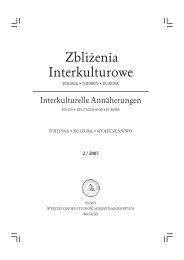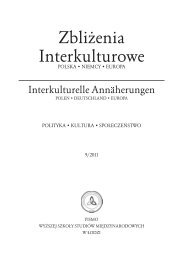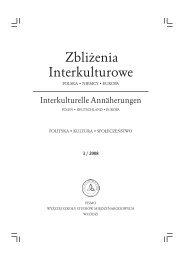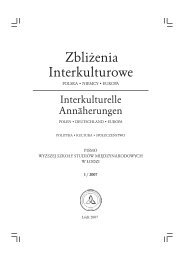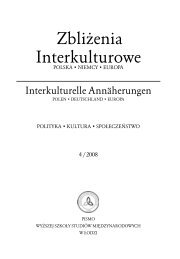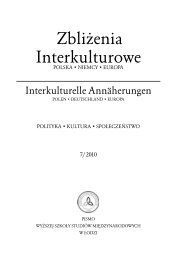zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
zeszyt nr 10/2011 - Zbliżenia Interkulturowe
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Martin Lowsky: Hurerei, Drangsal der Frauen und religiöse Metaphorik<br />
by das Segeln? Natürlich nicht, aber neben<br />
ihrer Arbeit hat sie noch Zeit für Freizeitbeschäftigungen<br />
von Niveau. Lene als gelegentliche<br />
aktive Seglerin – wer hätte das<br />
gedacht, nachdem Lene vorher im Roman<br />
als Beinahe-Unfallopfer in der Spree<br />
bei Stralau vorgestellt wurde. (Übrigens ist<br />
Lene auch Th eaterbesucherin, wie wir noch<br />
sehen werden.) Es ist überhaupt so, dass<br />
Lene im Laufe des Romans ‚sozial wächst’:<br />
Sie wird im 3. Kapitel als angestrengt plättendes<br />
Mädchen geschildert – was manche<br />
Interpreten dazu verleitet, sie grundsätzlich<br />
als Plätterin zu bezeichnen –, wird aber im<br />
8. Kapitel „Weißzeugdame“ genannt – was<br />
schon eine Stufe höher ist und sie zur Näherin<br />
macht –, und sie sagt im 16. Kapitel,<br />
ihr Arbeitgeber Goldstein habe einen Sonderauftrag<br />
für sie, nämlich Stickarbeiten für<br />
„die Wäsche der Waldeckschen Prinzessin“<br />
– wodurch sie sich als qualifi zierte Kunststickerin<br />
erweist.<br />
Unser zweiter und wichtigster Punkt<br />
ist das Th ema Prostitution. Betrachten wir<br />
hierzu die Szene im zweiten Teil des Romans,<br />
in der Gideon Franke, Lenes Bräutigam<br />
in spe, Botho aufsucht, um mit ihm<br />
über Lene zu sprechen. Warum hat Fontane<br />
diese Szene erdacht? Warum geht Gideon<br />
zu Botho, warum wagt er es, einen<br />
Adeligen um ein Gespräch zu bitten? Nur<br />
um über Lene zu plaudern, eine schlichte<br />
Neugier zu befriedigen? Nein, Gideon<br />
sucht Botho auf, um einen wichtigen heiklen<br />
Punkt zu klären, nämlich um zu erfahren,<br />
ob Bothos und Lenes intime Liaison<br />
auf Herzensliebe gegründet war oder<br />
ob es um Mätressenwirtschaft ging. Den<br />
ersten Fall, die Liebe, umschreibt Gideon<br />
mit: „in seines Fleisches Schwäche [leben]“,<br />
den anderen, schlimmen, mit: „in der Seele<br />
Niedrigkeit [stecken]“. Die beiden Herren<br />
führen ihr Gespräch in diskreten Formulierungen.<br />
Botho sagt, fast nur nebenbei,<br />
Lene habe den Stolz, „von ihrer Hände Arbeit<br />
leben zu wollen“. Damit erlebt Gideon<br />
die gewaltige Erleichterung, zu hören, dass<br />
in der Liebschaft der beiden kein Geld gefl<br />
ossen ist und allein das Wort von ‚des Fleisches<br />
Schwäche’ galt. Lene ist nicht Bothos<br />
Mätresse gewesen, ist nicht der käufl ichen<br />
Liebe verfallen. Gideons namenlose Freude<br />
über diese Nachricht zeigt sich in seiner<br />
anschließenden Redelust über „Proppertät“,<br />
„Honnettität“ und „Reellität“. Und<br />
wenn die Sachlage doch anders gewesen<br />
wäre? Dann hätte Gideon von Botho eine<br />
„Hurengeschichte“ 3 hören müssen. Dies ist<br />
nicht der Fall, aber der Gedanke an Hure<br />
und Prostitution hat für Gideon und für<br />
alle, die Lene kannten, im Raum gestanden.<br />
Dieser Gedanke ‚Prostitution’ ist im<br />
Roman gegenwärtig auch durch die Rückblicke<br />
auf Personen, die in käufl iche Liebe<br />
verwickelt sind; es sind Rückblicke, die sich<br />
am Anfang, in der Mitte und am Ende befi<br />
nden. Zuerst spricht Frau Dörr über ihre<br />
einstige Rolle als bezahlte Geliebte eines<br />
Grafen („Grässlich war es“). Später hören<br />
wir den Namen Agnes Sorel, einen Namen<br />
aus Schillers Jungfrau von Orleans, der eine<br />
historische Mätresse bezeichnet (1422–<br />
1450), die erste ‚maîtresse en titre’ in der<br />
Geschichte des französischen Königshofes.<br />
Botho gibt Lene vorübergehend diesen<br />
Spitznamen. Sodann kommt bei dem Ausfl<br />
ug Bothos und seiner Frau nach Charlottenburg<br />
die Rede auf Friedrich Wilhelm II.<br />
3 Das Wort „Hurengeschichte“ soll als schmähendes<br />
Urteil über Irrungen, Wirrungen in der<br />
Redaktion der Vossischen Zeitung gefallen sein anlässlich<br />
des Vorabdrucks. Siehe Co<strong>nr</strong>ad Wandrey:<br />
Th eodor Fontane. München 1919, S. 213.<br />
59