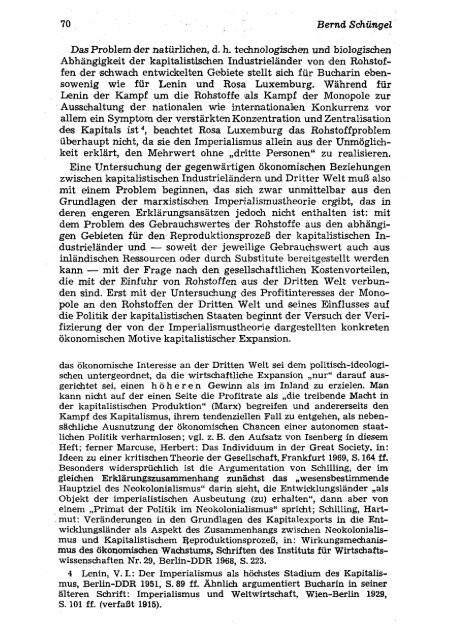Zur Politischen Ãkonomie des gegenwärtigen Imperialismus ...
Zur Politischen Ãkonomie des gegenwärtigen Imperialismus ...
Zur Politischen Ãkonomie des gegenwärtigen Imperialismus ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
70 Bernd, Schüngel<br />
Das Problem der natürlichen, d. h. technologischen und biologischen<br />
Abhängigkeit der kapitalistischen Industrieländer von den Rohstoffen<br />
der schwach entwickelten Gebiete stellt sich für Bucharin ebensowenig<br />
wie für Lenin und Rosa Luxemburg. Während für<br />
Lenin der Kampf um die Rohstoffe als Kampf der Monopole zur<br />
Ausschaltung der nationalen wie internationalen Konkurrenz vor<br />
allem ein Symptom der verstärkten Konzentration und Zentralisation<br />
<strong>des</strong> Kapitals ist 4 , beachtet Rosa Luxemburg das Rohstoffproblem<br />
überhaupt nicht, da sie den <strong>Imperialismus</strong> allein aus der Unmöglichkeit<br />
erklärt, den Mehrwert ohne „dritte Personen" zu realisieren.<br />
Eine Untersuchung der gegenwärtigen ökonomischen Beziehungen<br />
zwischen kapitalistischen Industrieländern und Dritter Welt muß also<br />
mit einem Problem beginnen, das sich zwar unmittelbar aus den<br />
Grundlagen der marxistischen <strong>Imperialismus</strong>theorie ergibt, das in<br />
deren engeren Erklärungsansätzen jedoch nicht enthalten ist: mit<br />
dem Problem <strong>des</strong> Gebrauchswertes der Rohstoffe aus den abhängigen<br />
Gebieten für den Reproduktionsprozeß der kapitalistischen Industrieländer<br />
und — soweit der jeweilige Gebrauchswert auch aus<br />
inländischen Ressourcen oder durch Substitute bereitgestellt werden<br />
kann — mit der Frage nach den gesellschaftlichen Kostenvorteilen,<br />
die mit der Einfuhr von Rohstoffen aus der Dritten Welt verbunden<br />
sind. Erst mit der Untersuchung <strong>des</strong> Profitinteresses der Monopole<br />
an den Rohstoffen der Dritten Welt und seines Einflusses auf<br />
die Politik der kapitalistischen Staaten beginnt der Versuch der Verifizierung<br />
der von der <strong>Imperialismus</strong>theorie dargestellten konkreten<br />
ökonomischen Motive kapitalistischer Expansion.<br />
das ökonomische Interesse an der Dritten Welt sei dem politisch-ideologischen<br />
untergeordnet, da die wirtschaftliche Expansion „nur" darauf ausgerichtet<br />
sei, einen höheren Gewinn als im Inland zu erzielen. Man<br />
kann nicht auf der einen Seite die Profitrate als „die treibende Macht in<br />
der kapitalistischen Produktion" (Marx) begreifen und andererseits den<br />
Kampf <strong>des</strong> Kapitalismus, ihrem tendenziellen Fall zu entgehen, als nebensächliche<br />
Ausnutzung der ökonomischen Chancen einer autonomen staatlichen<br />
Politik verharmlosen; vgl. z. B. den Aufsatz von Isenberg in diesem<br />
Heft; ferner Marcuse, Herbert: Das Individuum in der Great Society, in:<br />
Ideen zu einer kritischen Theorie der Gesellschaft, Frankfurt 1969, S. 164 ff.<br />
Besonders widersprüchlich ist die Argumentation von Schilling, der im<br />
gleichen Erklärungszusammenhang zunächst das „wesensbestimmende<br />
Hauptziel <strong>des</strong> Neokolonialismus" darin sieht, die Entwicklungsländer „als<br />
Objekt der imperialistischen Ausbeutung (zu) erhalten", dann aber von<br />
einem „Primat der Politik im Neokolonialismus" spricht; Schilling, Hartmut:<br />
Veränderungen in den Grundlagen <strong>des</strong> Kapitalexports in die Entwicklungsländer<br />
als Aspekt <strong>des</strong> Zusammenhangs zwischen Neokolonialismus<br />
und Kapitalistischem Reproduktionsprozeß, in: Wirkungsmechanismus<br />
<strong>des</strong> ökonomischen Wachstums, Schriften <strong>des</strong> Instituts für Wirtschaftswissenschaften<br />
Nr. 29, Berlin-DDR 1968, S. 223.<br />
4 Lenin, V. I.: Der <strong>Imperialismus</strong> als höchstes Stadium <strong>des</strong> Kapitalismus,<br />
Berlin-DDR 1951, S. 89 ff. Ähnlich argumentiert Bucharin in seiner<br />
älteren Schrift: <strong>Imperialismus</strong> und Weltwirtschaft, Wien-Berlin 1929,<br />
S. 101 ff. (verfaßt 1915).