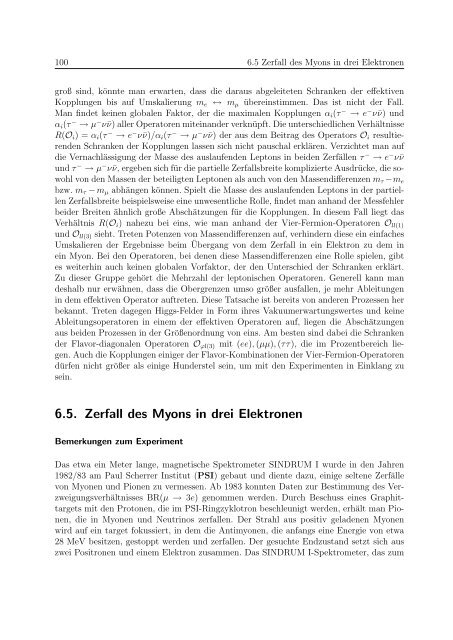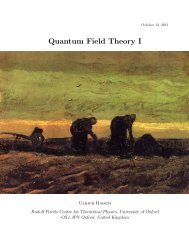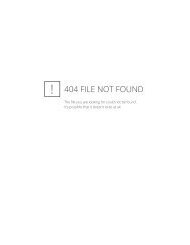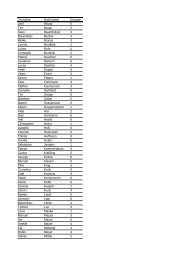PDF - THEP Mainz
PDF - THEP Mainz
PDF - THEP Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
100 6.5 Zerfall des Myons in drei Elektronen<br />
groß sind, könnte man erwarten, dass die daraus abgeleiteten Schranken der effektiven<br />
Kopplungen bis auf Umskalierung m e ↔ m µ übereinstimmen. Das ist nicht der Fall.<br />
Man findet keinen globalen Faktor, der die maximalen Kopplungen α i (τ − → e − ν¯ν) und<br />
α i (τ − → µ − ν¯ν) aller Operatoren miteinander verknüpft. Die unterschiedlichen Verhältnisse<br />
R(O i ) = α i (τ − → e − ν¯ν)/α i (τ − → µ − ν¯ν) der aus dem Beitrag des Operators O i resultierenden<br />
Schranken der Kopplungen lassen sich nicht pauschal erklären. Verzichtet man auf<br />
die Vernachlässigung der Masse des auslaufenden Leptons in beiden Zerfällen τ − → e − ν¯ν<br />
und τ − → µ − ν¯ν, ergeben sich für die partielle Zerfallsbreite komplizierte Ausdrücke, die sowohl<br />
von den Massen der beteiligten Leptonen als auch von den Massendifferenzen m τ −m e<br />
bzw. m τ − m µ abhängen können. Spielt die Masse des auslaufenden Leptons in der partiellen<br />
Zerfallsbreite beispielsweise eine unwesentliche Rolle, findet man anhand der Messfehler<br />
beider Breiten ähnlich große Abschätzungen für die Kopplungen. In diesem Fall liegt das<br />
Verhältnis R(O i ) nahezu bei eins, wie man anhand der Vier-Fermion-Operatoren O ll(1)<br />
und O ll(3) sieht. Treten Potenzen von Massendifferenzen auf, verhindern diese ein einfaches<br />
Umskalieren der Ergebnisse beim Übergang von dem Zerfall in ein Elektron zu dem in<br />
ein Myon. Bei den Operatoren, bei denen diese Massendifferenzen eine Rolle spielen, gibt<br />
es weiterhin auch keinen globalen Vorfaktor, der den Unterschied der Schranken erklärt.<br />
Zu dieser Gruppe gehört die Mehrzahl der leptonischen Operatoren. Generell kann man<br />
deshalb nur erwähnen, dass die Obergrenzen umso größer ausfallen, je mehr Ableitungen<br />
in dem effektiven Operator auftreten. Diese Tatsache ist bereits von anderen Prozessen her<br />
bekannt. Treten dagegen Higgs-Felder in Form ihres Vakuumerwartungswertes und keine<br />
Ableitungsoperatoren in einem der effektiven Operatoren auf, liegen die Abschätzungen<br />
aus beiden Prozessen in der Größenordnung von eins. Am besten sind dabei die Schranken<br />
der Flavor-diagonalen Operatoren O ϕl(3) mit (ee), (µµ), (ττ), die im Prozentbereich liegen.<br />
Auch die Kopplungen einiger der Flavor-Kombinationen der Vier-Fermion-Operatoren<br />
dürfen nicht größer als einige Hunderstel sein, um mit den Experimenten in Einklang zu<br />
sein.<br />
6.5. Zerfall des Myons in drei Elektronen<br />
Bemerkungen zum Experiment<br />
Das etwa ein Meter lange, magnetische Spektrometer SINDRUM I wurde in den Jahren<br />
1982/83 am Paul Scherrer Institut (PSI) gebaut und diente dazu, einige seltene Zerfälle<br />
von Myonen und Pionen zu vermessen. Ab 1983 konnten Daten zur Bestimmung des Verzweigungsverhältnisses<br />
BR(µ → 3e) genommen werden. Durch Beschuss eines Graphittargets<br />
mit den Protonen, die im PSI-Ringzyklotron beschleunigt werden, erhält man Pionen,<br />
die in Myonen und Neutrinos zerfallen. Der Strahl aus positiv geladenen Myonen<br />
wird auf ein target fokussiert, in dem die Antimyonen, die anfangs eine Energie von etwa<br />
28 MeV besitzen, gestoppt werden und zerfallen. Der gesuchte Endzustand setzt sich aus<br />
zwei Positronen und einem Elektron zusammen. Das SINDRUM I-Spektrometer, das zum