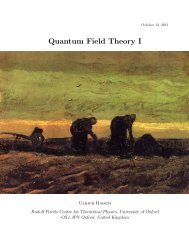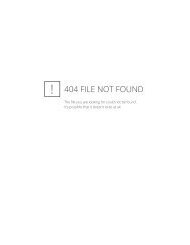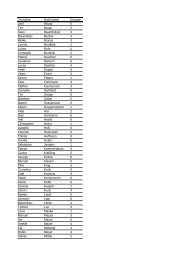PDF - THEP Mainz
PDF - THEP Mainz
PDF - THEP Mainz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
4. Modelle<br />
4.1. Compositeness<br />
Hinter dem Begriff Compositeness verbirgt sich die Annahme, dass Fermionen, Eichbosonen<br />
bzw. skalare Teilchen des Standardmodells keine elementaren Teilchen sind, sondern<br />
eine Substruktur besitzen. Wäre die Annahme korrekt, ließen sich insbesondere Leptonen<br />
und Quarks als Bindungszustände von mehreren anderen Komponenten beschreiben,<br />
die in bestimmten Modellen als Preonen bezeichnet werden. Auf diesen Fall wollen wir<br />
uns im Hinblick auf die oben aufgeführten effektiven Operatoren beschränken und auf die<br />
Diskussion anomalen Verhaltens der Eichbosonen und des Higgs-Bosons verzichten. Im Gegensatz<br />
zu Atomen, bei denen im Vergleich zu den Massen von Kern und Elektronen kleine<br />
Bindungsenergien vorliegen, müssen die Konstituenten der Quarks und Leptonen stark gebunden<br />
und verhältnismäßig leicht sein. Man führt eine sogenannte Compositeness-Skala<br />
Λ C ein, die in dieser Beschreibung die Rolle des Entwicklungsparameters Λ in dem effektiven<br />
Ansatz (3.1) übernimmt. Die Längenskala, auf der die Substruktur gesehen werden<br />
kann, ist 1/Λ C . Die Physik der Bausteine von Quarks und Leptonen spielt sich im Bereich<br />
Λ C ab und ist deshalb relativistisch zu behandeln. Phänomene, die mit der Substruktur<br />
von Leptonen und Quarks zusammenhängen, sind umgekehrt im Niederenergiebereich mit<br />
unterdrückt. Die dominanten Effekte sind wiederum durch effektive Operatoren<br />
mit der kleinstmöglichen Massendimension größer vier zu erwarten, d.h. von Vier-<br />
Fermion-Operatoren der Form (3.12)–(3.15) für Leptonen bzw. (3.26)–(3.34) für Lepton-<br />
Quark-Wechselwirkungen. Diese werden im folgenden Abschnitt näher untersucht. Modelle<br />
in denen eine oder beide Komponenten ψ L und ψ R zusammengesetzte Teilchen sind, enthalten<br />
Kontaktwechselwirkungs-Terme, die helizitätserhaltend sind [61]. Die Lagrange-Dichte<br />
kann dann in der Form ausgedrückt werden<br />
Potenzen von Λ −1<br />
C<br />
L C = g2<br />
(α<br />
2Λ 2 LL ψ L γ µ ψ L ψ L γ µ ψ L + α RR ψ R γ µ ψ R ψ R γ µ ψ R<br />
C<br />
+α LR ψ L γ µ ψ L ψ R γ µ ψ R + α RL ψ R γ µ ψ R ψ L γ µ ψ L ), (4.1)<br />
wobei ψ L die Komponenten u, d, ν, e der linkshändigen Quark- bzw. Leptondubletts bezeichnet,<br />
während ψ R für die rechtshändigen Fermionen u, d, e steht. Auf Generationenindizes<br />
verzichten wir der Übersichtlichkeit halber. Den so beschriebenen Wechselwirkungen<br />
können der Austausch von Preonen oder Feldquanten zwischen den Fermionen zugrunde<br />
liegen. Neben der Vier-Fermion-Wechselwirkung, die oft auch als Kontaktwechselwirkung