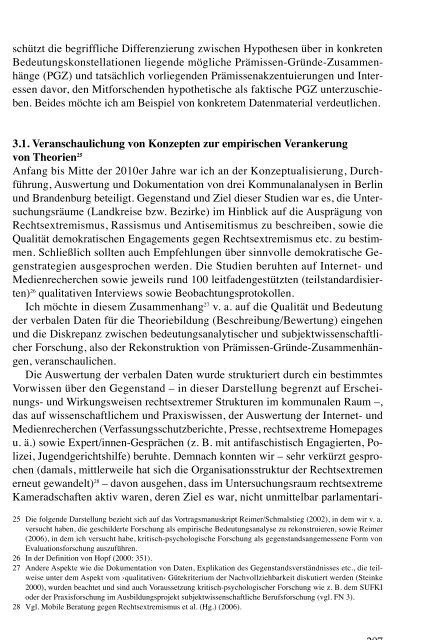Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
schützt die begriffliche Differenzierung zwischen Hypothesen über in konkreten<br />
Bedeutungskonstellationen liegende mögliche Prämissen-Gründe-Zusammenhänge<br />
(PGZ) und tatsächlich vorliegenden Prämissenakzentuierungen und Interessen<br />
davor, den Mitforschenden hypothetische als faktische PGZ unterzuschieben.<br />
Beides möchte ich am Beispiel von konkretem Datenmaterial verdeutlichen.<br />
3.1. Veranschaulichung von Konzepten zur empirischen Verankerung<br />
von Theorien 25<br />
Anfang bis Mitte der 2010er Jahre war ich an der Konzeptualisierung, Durchführung,<br />
Auswertung und Dokumentation von drei Kommunalanalysen in Berlin<br />
und Brandenburg beteiligt. Gegenstand und Ziel dieser Studien war es, die Untersuchungsräume<br />
(Landkreise bzw. Bezirke) im Hinblick auf die Ausprägung von<br />
Rechtsextremismus, Rassismus und Antise<strong>mit</strong>ismus zu beschreiben, sowie die<br />
Qualität demokratischen Engagements gegen Rechtsextremismus etc. zu bestimmen.<br />
Schließlich sollten auch Empfehlungen über sinnvolle demokratische Gegenstrategien<br />
ausgesprochen werden. Die Studien beruhten auf Internet- und<br />
Medienrecherchen sowie jeweils rund 100 leitfadengestützten (teilstandardisierten)<br />
26 qualitativen Interviews sowie Beobachtungsprotokollen.<br />
Ich möchte in diesem Zusammenhang 27 v. a. auf die Qualität und Bedeutung<br />
der verbalen Daten für die Theoriebildung (Beschreibung/Bewertung) eingehen<br />
und die Diskrepanz zwischen bedeutungsanalytischer und subjektwissenschaftlicher<br />
Forschung, also der Rekonstruktion von Prämissen-Gründe-Zusammenhängen,<br />
veranschaulichen.<br />
Die Auswertung der verbalen Daten wurde strukturiert durch ein bestimmtes<br />
Vorwissen über den Gegenstand – in dieser Darstellung begrenzt auf Erscheinungs-<br />
und Wirkungsweisen rechtsextremer Strukturen im kommunalen Raum –,<br />
das auf wissenschaftlichem und Praxiswissen, der Auswertung der Internet- und<br />
Medienrecherchen (Verfassungsschutzberichte, Presse, rechtsextreme Homepages<br />
u. ä.) sowie Expert/innen-Gesprächen (z. B. <strong>mit</strong> antifaschistisch Engagierten, Polizei,<br />
Jugendgerichtshilfe) beruhte. Demnach konnten wir – sehr verkürzt gesprochen<br />
(damals, <strong>mit</strong>tlerweile hat sich die Organisationsstruktur der Rechtsextremen<br />
erneut gewandelt) 28 – davon ausgehen, dass im Untersuchungsraum rechtsextreme<br />
Kameradschaften aktiv waren, deren Ziel es war, nicht un<strong>mit</strong>telbar parlamentari-<br />
25 Die folgende Darstellung bezieht sich auf das Vortragsmanuskript Reimer/Schmalstieg (2002), in dem wir v. a.<br />
versucht haben, die geschilderte Forschung als empirische Bedeutungsanalyse zu rekonstruieren, sowie Reimer<br />
(2006), in dem ich versucht habe, kritisch-psychologische Forschung als gegenstandsangemessene Form von<br />
Evaluationsforschung auszuführen.<br />
26 In der Definition von Hopf (2000: 351).<br />
27 Andere Aspekte wie die Dokumentation von Daten, Explikation des Gegenstandsverständnisses etc., die teilweise<br />
unter dem Aspekt vom ›qualitativen‹ Gütekriterium der Nachvollziehbarkeit diskutiert werden (Steinke<br />
2000), wurden beachtet und sind auch Voraussetzung kritisch-psychologischer Forschung wie z. B. dem SUFKI<br />
oder der Praxisforschung im Ausbildungsprojekt subjektwissenschaftliche Berufsforschung (vgl. FN 3).<br />
28 Vgl. Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus et al. (Hg.) (2006).<br />
207