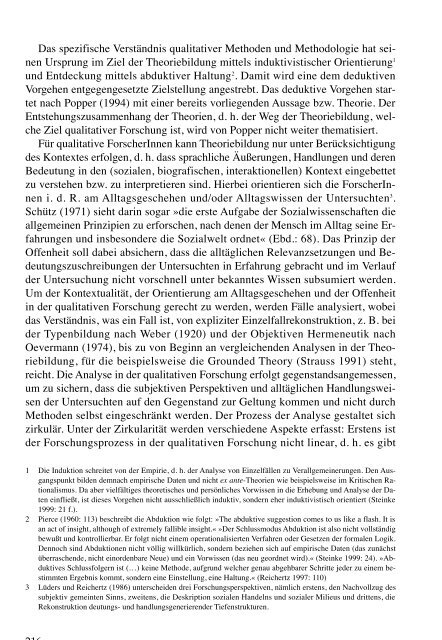Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Das spezifische Verständnis qualitativer <strong>Methode</strong>n und Methodologie hat seinen<br />
Ursprung im Ziel der Theoriebildung <strong>mit</strong>tels induktivistischer Orientierung 1<br />
und Entdeckung <strong>mit</strong>tels abduktiver Haltung 2 . Da<strong>mit</strong> wird eine dem deduktiven<br />
Vorgehen entgegengesetzte Zielstellung angestrebt. Das deduktive Vorgehen startet<br />
nach Popper (1994) <strong>mit</strong> einer bereits vorliegenden Aussage bzw. Theorie. Der<br />
Entstehungszusammenhang der Theorien, d. h. der Weg der Theoriebildung, welche<br />
Ziel qualitativer Forschung ist, wird von Popper nicht weiter thematisiert.<br />
Für qualitative ForscherInnen kann Theoriebildung nur unter Berücksichtigung<br />
des Kontextes erfolgen, d. h. dass sprachliche Äußerungen, Handlungen und deren<br />
Bedeutung in den (sozialen, biografischen, interaktionellen) Kontext eingebettet<br />
zu verstehen bzw. zu interpretieren sind. Hierbei orientieren sich die ForscherInnen<br />
i. d. R. am Alltagsgeschehen und/oder Alltagswissen der Untersuchten 3 .<br />
Schütz (1971) sieht darin sogar »die erste Aufgabe der Sozialwissenschaften die<br />
allgemeinen Prinzipien zu erforschen, nach denen der Mensch im Alltag seine Erfahrungen<br />
und insbesondere die Sozialwelt ordnet« (Ebd.: 68). Das Prinzip der<br />
Offenheit soll dabei absichern, dass die alltäglichen Relevanzsetzungen und Bedeutungszuschreibungen<br />
der Untersuchten in Erfahrung gebracht und im Verlauf<br />
der Untersuchung nicht vorschnell unter bekanntes Wissen subsumiert werden.<br />
Um der Kontextualität, der Orientierung am Alltagsgeschehen und der Offenheit<br />
in der qualitativen Forschung gerecht zu werden, werden Fälle analysiert, wobei<br />
das Verständnis, was ein Fall ist, von expliziter Einzelfallrekonstruktion, z. B. bei<br />
der Typenbildung nach Weber (1920) und der Objektiven Hermeneutik nach<br />
Oevermann (1974), bis zu von Beginn an vergleichenden Analysen in der Theoriebildung,<br />
für die beispielsweise die Grounded Theory (Strauss 1991) steht,<br />
reicht. Die Analyse in der qualitativen Forschung erfolgt gegenstandsangemessen,<br />
um zu sichern, dass die subjektiven Perspektiven und alltäglichen Handlungsweisen<br />
der Untersuchten auf den Gegenstand zur Geltung kommen und nicht durch<br />
<strong>Methode</strong>n selbst eingeschränkt werden. Der Prozess der Analyse gestaltet sich<br />
zirkulär. Unter der Zirkularität werden verschiedene Aspekte erfasst: Erstens ist<br />
der Forschungsprozess in der qualitativen Forschung nicht linear, d. h. es gibt<br />
1 Die Induktion schreitet von der Empirie, d. h. der Analyse von Einzelfällen zu Verallgemeinerungen. Den Ausgangspunkt<br />
bilden demnach empirische Daten und nicht ex ante-Theorien wie beispielsweise im Kritischen Rationalismus.<br />
Da aber vielfältiges theoretisches und persönliches Vorwissen in die Erhebung und Analyse der Daten<br />
einfließt, ist dieses Vorgehen nicht ausschließlich induktiv, sondern eher induktivistisch orientiert (Steinke<br />
1999: 21 f.).<br />
2 Pierce (1960: 113) beschreibt die Abduktion wie folgt: »The abduktive suggestion comes to us like a flash. It is<br />
an act of insight, although of extremely fallible insight.« »Der Schlussmodus Abduktion ist also nicht vollständig<br />
bewußt und kontrollierbar. Er folgt nicht einem operationalisierten Verfahren oder Gesetzen der formalen Logik.<br />
Dennoch sind Abduktionen nicht völlig willkürlich, sondern beziehen sich auf empirische Daten (das zunächst<br />
überraschende, nicht einordenbare Neue) und ein Vorwissen (das neu geordnet wird).« (Steinke 1999: 24). »Abduktives<br />
Schlussfolgern ist (…) keine <strong>Methode</strong>, aufgrund welcher genau abgehbarer Schritte jeder zu einem bestimmten<br />
Ergebnis kommt, sondern eine Einstellung, eine Haltung.« (Reichertz 1997: 110)<br />
3 Lüders und Reichertz (1986) unterscheiden drei Forschungsperspektiven, nämlich erstens, den Nachvollzug des<br />
subjektiv gemeinten Sinns, zweitens, die Deskription sozialen Handelns und sozialer Milieus und drittens, die<br />
Rekonstruktion deutungs- und handlungsgenerierender Tiefenstrukturen.<br />
216