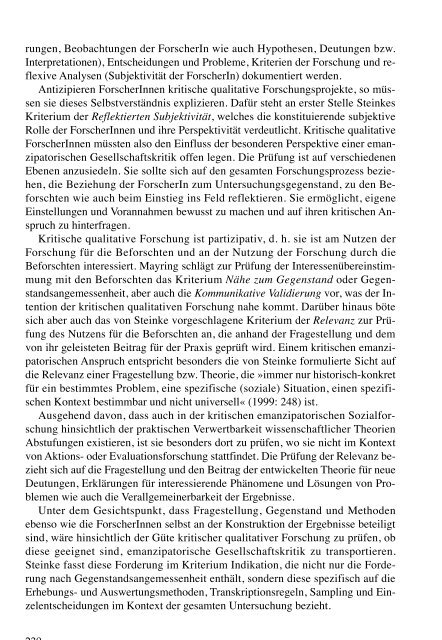Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Kritik mit Methode? - Rosa-Luxemburg-Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
ungen, Beobachtungen der ForscherIn wie auch Hypothesen, Deutungen bzw.<br />
Interpretationen), Entscheidungen und Probleme, Kriterien der Forschung und reflexive<br />
Analysen (Subjektivität der ForscherIn) dokumentiert werden.<br />
Antizipieren ForscherInnen kritische qualitative Forschungsprojekte, so müssen<br />
sie dieses Selbstverständnis explizieren. Dafür steht an erster Stelle Steinkes<br />
Kriterium der Reflektierten Subjektivität, welches die konstituierende subjektive<br />
Rolle der ForscherInnen und ihre Perspektivität verdeutlicht. Kritische qualitative<br />
ForscherInnen müssten also den Einfluss der besonderen Perspektive einer emanzipatorischen<br />
Gesellschaftskritik offen legen. Die Prüfung ist auf verschiedenen<br />
Ebenen anzusiedeln. Sie sollte sich auf den gesamten Forschungsprozess beziehen,<br />
die Beziehung der ForscherIn zum Untersuchungsgegenstand, zu den Beforschten<br />
wie auch beim Einstieg ins Feld reflektieren. Sie ermöglicht, eigene<br />
Einstellungen und Vorannahmen bewusst zu machen und auf ihren kritischen Anspruch<br />
zu hinterfragen.<br />
Kritische qualitative Forschung ist partizipativ, d. h. sie ist am Nutzen der<br />
Forschung für die Beforschten und an der Nutzung der Forschung durch die<br />
Beforschten interessiert. Mayring schlägt zur Prüfung der Interessenübereinstimmung<br />
<strong>mit</strong> den Beforschten das Kriterium Nähe zum Gegenstand oder Gegenstandsangemessenheit,<br />
aber auch die Kommunikative Validierung vor, was der Intention<br />
der kritischen qualitativen Forschung nahe kommt. Darüber hinaus böte<br />
sich aber auch das von Steinke vorgeschlagene Kriterium der Relevanz zur Prüfung<br />
des Nutzens für die Beforschten an, die anhand der Fragestellung und dem<br />
von ihr geleisteten Beitrag für der Praxis geprüft wird. Einem kritischen emanzipatorischen<br />
Anspruch entspricht besonders die von Steinke formulierte Sicht auf<br />
die Relevanz einer Fragestellung bzw. Theorie, die »immer nur historisch-konkret<br />
für ein bestimmtes Problem, eine spezifische (soziale) Situation, einen spezifischen<br />
Kontext bestimmbar und nicht universell« (1999: 248) ist.<br />
Ausgehend davon, dass auch in der kritischen emanzipatorischen Sozialforschung<br />
hinsichtlich der praktischen Verwertbarkeit wissenschaftlicher Theorien<br />
Abstufungen existieren, ist sie besonders dort zu prüfen, wo sie nicht im Kontext<br />
von Aktions- oder Evaluationsforschung stattfindet. Die Prüfung der Relevanz bezieht<br />
sich auf die Fragestellung und den Beitrag der entwickelten Theorie für neue<br />
Deutungen, Erklärungen für interessierende Phänomene und Lösungen von Problemen<br />
wie auch die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse.<br />
Unter dem Gesichtspunkt, dass Fragestellung, Gegenstand und <strong>Methode</strong>n<br />
ebenso wie die ForscherInnen selbst an der Konstruktion der Ergebnisse beteiligt<br />
sind, wäre hinsichtlich der Güte kritischer qualitativer Forschung zu prüfen, ob<br />
diese geeignet sind, emanzipatorische Gesellschaftskritik zu transportieren.<br />
Steinke fasst diese Forderung im Kriterium Indikation, die nicht nur die Forderung<br />
nach Gegenstandsangemessenheit enthält, sondern diese spezifisch auf die<br />
Erhebungs- und Auswertungsmethoden, Transkriptionsregeln, Sampling und Einzelentscheidungen<br />
im Kontext der gesamten Untersuchung bezieht.<br />
230