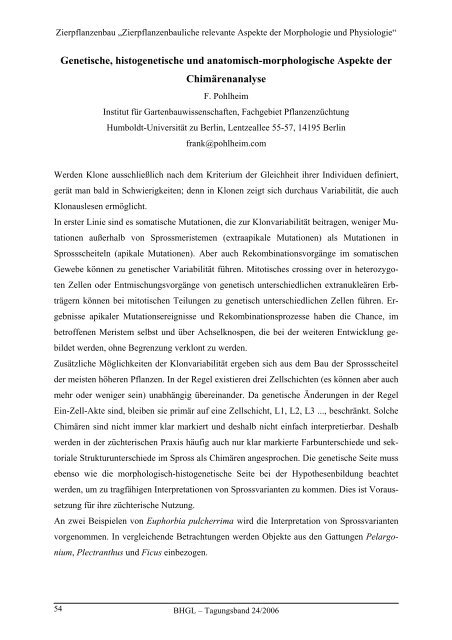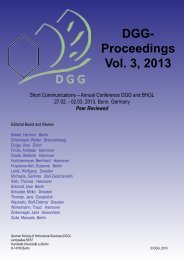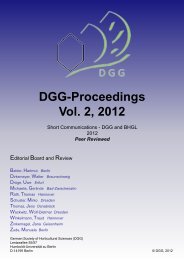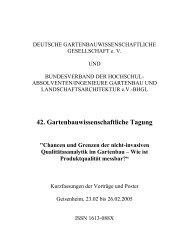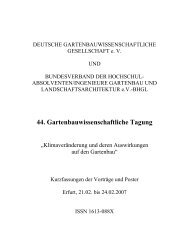43. Gartenbauwissenschaftliche Tagung - (DGG) und des
43. Gartenbauwissenschaftliche Tagung - (DGG) und des
43. Gartenbauwissenschaftliche Tagung - (DGG) und des
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Zierpflanzenbau „Zierpflanzenbauliche relevante Aspekte der Morphologie <strong>und</strong> Physiologie“<br />
54<br />
Genetische, histogenetische <strong>und</strong> anatomisch-morphologische Aspekte der<br />
Chimärenanalyse<br />
F. Pohlheim<br />
Institut für Gartenbauwissenschaften, Fachgebiet Pflanzenzüchtung<br />
Humboldt-Universität zu Berlin, Lentzeallee 55-57, 14195 Berlin<br />
frank@pohlheim.com<br />
Werden Klone ausschließlich nach dem Kriterium der Gleichheit ihrer Individuen definiert,<br />
gerät man bald in Schwierigkeiten; denn in Klonen zeigt sich durchaus Variabilität, die auch<br />
Klonauslesen ermöglicht.<br />
In erster Linie sind es somatische Mutationen, die zur Klonvariabilität beitragen, weniger Mutationen<br />
außerhalb von Sprossmeristemen (extraapikale Mutationen) als Mutationen in<br />
Sprossscheiteln (apikale Mutationen). Aber auch Rekombinationsvorgänge im somatischen<br />
Gewebe können zu genetischer Variabilität führen. Mitotisches crossing over in heterozygoten<br />
Zellen oder Entmischungsvorgänge von genetisch unterschiedlichen extranukleären Erbträgern<br />
können bei mitotischen Teilungen zu genetisch unterschiedlichen Zellen führen. Ergebnisse<br />
apikaler Mutationsereignisse <strong>und</strong> Rekombinationsprozesse haben die Chance, im<br />
betroffenen Meristem selbst <strong>und</strong> über Achselknospen, die bei der weiteren Entwicklung gebildet<br />
werden, ohne Begrenzung verklont zu werden.<br />
Zusätzliche Möglichkeiten der Klonvariabilität ergeben sich aus dem Bau der Sprossscheitel<br />
der meisten höheren Pflanzen. In der Regel existieren drei Zellschichten (es können aber auch<br />
mehr oder weniger sein) unabhängig übereinander. Da genetische Änderungen in der Regel<br />
Ein-Zell-Akte sind, bleiben sie primär auf eine Zellschicht, L1, L2, L3 ..., beschränkt. Solche<br />
Chimären sind nicht immer klar markiert <strong>und</strong> <strong>des</strong>halb nicht einfach interpretierbar. Deshalb<br />
werden in der züchterischen Praxis häufig auch nur klar markierte Farbunterschiede <strong>und</strong> sektoriale<br />
Strukturunterschiede im Spross als Chimären angesprochen. Die genetische Seite muss<br />
ebenso wie die morphologisch-histogenetische Seite bei der Hypothesenbildung beachtet<br />
werden, um zu tragfähigen Interpretationen von Sprossvarianten zu kommen. Dies ist Voraussetzung<br />
für ihre züchterische Nutzung.<br />
An zwei Beispielen von Euphorbia pulcherrima wird die Interpretation von Sprossvarianten<br />
vorgenommen. In vergleichende Betrachtungen werden Objekte aus den Gattungen Pelargonium,<br />
Plectranthus <strong>und</strong> Ficus einbezogen.<br />
BHGL – <strong>Tagung</strong>sband 24/2006