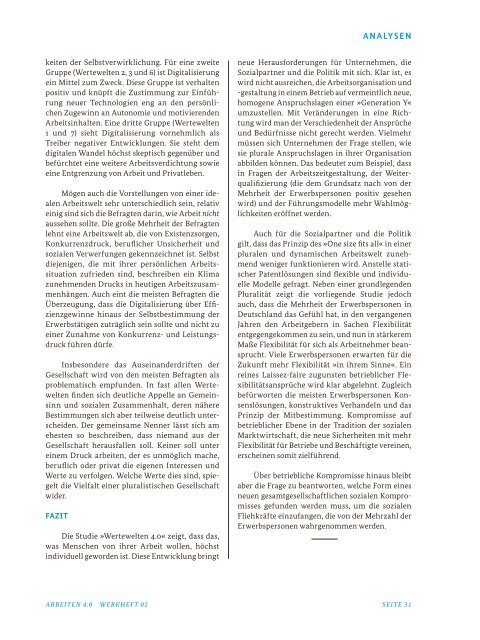Diskurslage erweiterte Dialogprozesses Veränderungen
BMAS_Werkheft-2
BMAS_Werkheft-2
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Analysen<br />
keiten der Selbstverwirklichung. Für eine zweite<br />
Gruppe (Wertewelten 2, 3 und 6) ist Digitalisierung<br />
ein Mittel zum Zweck. Diese Gruppe ist verhalten<br />
positiv und knüpft die Zustimmung zur Einführung<br />
neuer Technologien eng an den persönlichen<br />
Zugewinn an Autonomie und motivierenden<br />
Arbeitsinhalten. Eine dritte Gruppe (Wertewelten<br />
1 und 7) sieht Digitalisierung vornehmlich als<br />
Treiber negativer Entwicklungen. Sie steht dem<br />
digitalen Wandel höchst skeptisch gegenüber und<br />
befürchtet eine weitere Arbeitsverdichtung sowie<br />
eine Entgrenzung von Arbeit und Privatleben.<br />
Mögen auch die Vorstellungen von einer idealen<br />
Arbeitswelt sehr unterschiedlich sein, relativ<br />
einig sind sich die Befragten darin, wie Arbeit nicht<br />
aussehen sollte. Die große Mehrheit der Befragten<br />
lehnt eine Arbeitswelt ab, die von Existenzsorgen,<br />
Konkurrenzdruck, beruflicher Unsicherheit und<br />
sozialen Verwerfungen gekennzeichnet ist. Selbst<br />
diejenigen, die mit ihrer persönlichen Arbeitssituation<br />
zufrieden sind, beschreiben ein Klima<br />
zunehmenden Drucks in heutigen Arbeitszusammenhängen.<br />
Auch eint die meisten Befragten die<br />
Überzeugung, dass die Digitalisierung über Effizienzgewinne<br />
hinaus der Selbstbestimmung der<br />
Erwerbstätigen zuträglich sein sollte und nicht zu<br />
einer Zunahme von Konkurrenz- und Leistungsdruck<br />
führen dürfe.<br />
Insbesondere das Auseinanderdriften der<br />
Gesellschaft wird von den meisten Befragten als<br />
problematisch empfunden. In fast allen Wertewelten<br />
finden sich deutliche Appelle an Gemeinsinn<br />
und sozialen Zusammenhalt, deren nähere<br />
Bestimmungen sich aber teilweise deutlich unterscheiden.<br />
Der gemeinsame Nenner lässt sich am<br />
ehesten so beschreiben, dass niemand aus der<br />
Gesellschaft herausfallen soll. Keiner soll unter<br />
einem Druck arbeiten, der es unmöglich mache,<br />
beruflich oder privat die eigenen Interessen und<br />
Werte zu verfolgen. Welche Werte dies sind, spiegelt<br />
die Vielfalt einer pluralistischen Gesellschaft<br />
wider.<br />
FAZIT<br />
Die Studie »Wertewelten 4.0« zeigt, dass das,<br />
was Menschen von ihrer Arbeit wollen, höchst<br />
individuell geworden ist. Diese Entwicklung bringt<br />
neue Herausforderungen für Unternehmen, die<br />
Sozialpartner und die Politik mit sich. Klar ist, es<br />
wird nicht ausreichen, die Arbeitsorganisation und<br />
-gestaltung in einem Betrieb auf vermeintlich neue,<br />
homogene Anspruchslagen einer »Generation Y«<br />
umzustellen. Mit <strong>Veränderungen</strong> in eine Richtung<br />
wird man der Verschiedenheit der Ansprüche<br />
und Bedürfnisse nicht gerecht werden. Vielmehr<br />
müssen sich Unternehmen der Frage stellen, wie<br />
sie plurale Anspruchslagen in ihrer Organisation<br />
abbilden können. Das bedeutet zum Beispiel, dass<br />
in Fragen der Arbeitszeitgestaltung, der Weiterqualifizierung<br />
(die dem Grundsatz nach von der<br />
Mehrheit der Erwerbspersonen positiv gesehen<br />
wird) und der Führungsmodelle mehr Wahlmöglichkeiten<br />
eröffnet werden.<br />
Auch für die Sozialpartner und die Politik<br />
gilt, dass das Prinzip des »One size fits all« in einer<br />
pluralen und dynamischen Arbeitswelt zunehmend<br />
weniger funktionieren wird. Anstelle statischer<br />
Patentlösungen sind flexible und individuelle<br />
Modelle gefragt. Neben einer grundlegenden<br />
Pluralität zeigt die vorliegende Studie jedoch<br />
auch, dass die Mehrheit der Erwerbspersonen in<br />
Deutschland das Gefühl hat, in den vergangenen<br />
Jahren den Arbeitgebern in Sachen Flexibilität<br />
entgegengekommen zu sein, und nun in stärkerem<br />
Maße Flexibilität für sich als Arbeitnehmer beansprucht.<br />
Viele Erwerbspersonen erwarten für die<br />
Zukunft mehr Flexibilität »in ihrem Sinne«. Ein<br />
reines Laissez-faire zugunsten betrieblicher Flexibilitätsansprüche<br />
wird klar abgelehnt. Zugleich<br />
befürworten die meisten Erwerbspersonen Konsenslösungen,<br />
konstruktives Verhandeln und das<br />
Prinzip der Mitbestimmung. Kompromisse auf<br />
betrieblicher Ebene in der Tradition der sozialen<br />
Marktwirtschaft, die neue Sicherheiten mit mehr<br />
Flexibilität für Betriebe und Beschäftigte vereinen,<br />
erscheinen somit zielführend.<br />
Über betriebliche Kompromisse hinaus bleibt<br />
aber die Frage zu beantworten, welche Form eines<br />
neuen gesamtgesellschaftlichen sozialen Kompromisses<br />
gefunden werden muss, um die sozialen<br />
Fliehkräfte einzufangen, die von der Mehrzahl der<br />
Erwerbspersonen wahrgenommen werden.<br />
ARBEITEN 4.0 WERKHEFT 02 SEITE 31