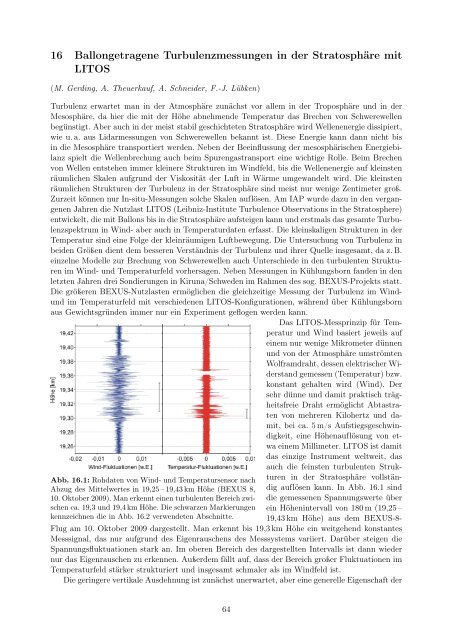Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
16 Ballongetragene Turbulenzmessungen in der Stratosphäre mit<br />
LITOS<br />
(M. Gerding, A. Theuerkauf, A. Schneider, F.-J. Lübken)<br />
Turbulenz erwartet man in der Atmosphäre zunächst vor allem in der Troposphäre und in der<br />
Mesosphäre, da hier die mit der Höhe abnehmende Temperatur das Brechen von Schwerewellen<br />
begünstigt. Aber auch in der meist stabil geschichteten Stratosphäre wird Wellenenergie dissipiert,<br />
wie u. a. aus Lidarmessungen von Schwerewellen bekannt ist. Diese Energie kann dann nicht bis<br />
in die Mesosphäre transportiert werden. Neben der Beeinflussung der mesosphärischen Energiebilanz<br />
spielt die Wellenbrechung auch beim Spurengastransport eine wichtige Rolle. Beim Brechen<br />
von Wellen entstehen immer kleinere Strukturen im Windfeld, bis die Wellenenergie auf kleinsten<br />
räumlichen Skalen aufgrund der Viskosität der Luft in Wärme umgewandelt wird. Die kleinsten<br />
räumlichen Strukturen der Turbulenz in der Stratosphäre sind meist nur wenige Zentimeter groß.<br />
Zurzeit können nur In-situ-Messungen solche Skalen auflösen. Am IAP wurde dazu in den vergangenen<br />
Jahren die Nutzlast LITOS (<strong>Leibniz</strong>-<strong>Institut</strong>e Turbulence Observations in the Stratosphere)<br />
entwickelt, die mit Ballons bis in die Stratosphäre aufsteigen kann und erstmals das gesamte Turbulenzspektrum<br />
in Wind- aber auch in Temperaturdaten erfasst. Die kleinskaligen Strukturen in der<br />
Temperatur sind eine Folge der kleinräumigen Luftbewegung. Die Untersuchung von Turbulenz in<br />
beiden Größen dient dem besseren Verständnis der Turbulenz und ihrer Quelle insgesamt, da z. B.<br />
einzelne Modelle zur Brechung von Schwerewellen auch Unterschiede in den turbulenten Strukturen<br />
im Wind- und Temperaturfeld vorhersagen. Neben Messungen in Kühlungsborn fanden in den<br />
letzten Jahren drei Sondierungen in Kiruna/Schweden im Rahmen des sog. BEXUS-Projekts statt.<br />
Die größeren BEXUS-Nutzlasten ermöglichen die gleichzeitige Messung der Turbulenz im Windund<br />
im Temperaturfeld mit verschiedenen LITOS-Konfigurationen, während über Kühlungsborn<br />
aus Gewichtsgründen immer nur ein Experiment geflogen werden kann.<br />
Abb. 16.1: Rohdaten von Wind- und Temperatursensor nach<br />
Abzug des Mittelwertes in 19,25 – 19,43 km Höhe (BEXUS 8,<br />
10. Oktober 2009). Man erkennt einen turbulenten Bereich zwischen<br />
ca. 19,3 und 19,4 km Höhe. Die schwarzen Markierungen<br />
kennzeichnen die in Abb. 16.2 verwendeten Abschnitte.<br />
Das LITOS-Messprinzip für Temperatur<br />
und Wind basiert jeweils auf<br />
einem nur wenige Mikrometer dünnen<br />
und von der Atmosphäre umströmten<br />
Wolframdraht, dessen elektrischer Widerstand<br />
gemessen (Temperatur) bzw.<br />
konstant gehalten wird (Wind). Der<br />
sehr dünne und damit praktisch trägheitsfreie<br />
Draht ermöglicht Abtastraten<br />
von mehreren Kilohertz und damit,<br />
bei ca. 5 m/s Aufstiegsgeschwindigkeit,<br />
eine Höhenauflösung von etwa<br />
einem Millimeter. LITOS ist damit<br />
das einzige Instrument weltweit, das<br />
auch die feinsten turbulenten Strukturen<br />
in der Stratosphäre vollständig<br />
auflösen kann. In Abb. 16.1 sind<br />
die gemessenen Spannungswerte über<br />
ein Höhenintervall von 180 m (19,25 –<br />
19,43 km Höhe) aus dem BEXUS-8-<br />
Flug am 10. Oktober 2009 dargestellt. Man erkennt bis 19,3 km Höhe ein weitgehend konstantes<br />
Messsignal, das nur aufgrund des Eigenrauschens des Messsystems variiert. Darüber steigen die<br />
Spannungsfluktuationen stark an. Im oberen Bereich des dargestellten Intervalls ist dann wieder<br />
nur das Eigenrauschen zu erkennen. Außerdem fällt auf, dass der Bereich großer Fluktuationen im<br />
Temperaturfeld stärker strukturiert und insgesamt schmaler als im Windfeld ist.<br />
Die geringere vertikale Ausdehnung ist zunächst unerwartet, aber eine generelle Eigenschaft der<br />
64