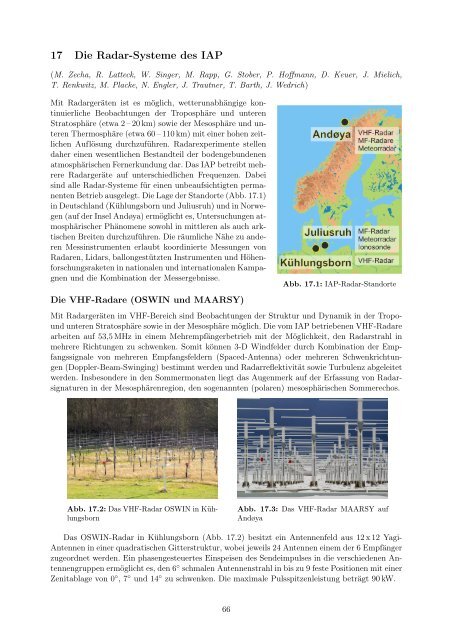Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Institutsbericht 2010/2011 - Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
17 Die Radar-Systeme des IAP<br />
(M. Zecha, R. Latteck, W. Singer, M. Rapp, G. Stober, P. Hoffmann, D. Keuer, J. Mielich,<br />
T. Renkwitz, M. Placke, N. Engler, J. Trautner, T. Barth, J. Wedrich)<br />
Mit Radargeräten ist es möglich, wetterunabhängige kontinuierliche<br />
Beobachtungen der Troposphäre und unteren<br />
Stratosphäre (etwa 2 – 20 km) sowie der Mesosphäre und unteren<br />
Thermosphäre (etwa 60 – 110 km) mit einer hohen zeitlichen<br />
Auflösung durchzuführen. Radarexperimente stellen<br />
daher einen wesentlichen Bestandteil der bodengebundenen<br />
atmosphärischen Fernerkundung dar. Das IAP betreibt mehrere<br />
Radargeräte auf unterschiedlichen Frequenzen. Dabei<br />
sind alle Radar-Systeme für einen unbeaufsichtigten permanenten<br />
Betrieb ausgelegt. Die Lage der Standorte (Abb. 17.1)<br />
in Deutschland (Kühlungsborn und Juliusruh) und in Norwegen<br />
(auf der Insel Andøya) ermöglicht es, Untersuchungen atmosphärischer<br />
Phänomene sowohl in mittleren als auch arktischen<br />
Breiten durchzuführen. Die räumliche Nähe zu anderen<br />
Messinstrumenten erlaubt koordinierte Messungen von<br />
Radaren, Lidars, ballongestützten Instrumenten und Höhenforschungsraketen<br />
in nationalen und internationalen Kampagnen<br />
und die Kombination der Messergebnisse.<br />
Die VHF-Radare (OSWIN und MAARSY)<br />
Abb. 17.1: IAP-Radar-Standorte<br />
Mit Radargeräten im VHF-Bereich sind Beobachtungen der Struktur und Dynamik in der Tropound<br />
unteren Stratosphäre sowie in der Mesosphäre möglich. Die vom IAP betriebenen VHF-Radare<br />
arbeiten auf 53,5 MHz in einem Mehrempfängerbetrieb mit der Möglichkeit, den Radarstrahl in<br />
mehrere Richtungen zu schwenken. Somit können 3-D Windfelder durch Kombination der Empfangssignale<br />
von mehreren Empfangsfeldern (Spaced-Antenna) oder mehreren Schwenkrichtungen<br />
(Doppler-Beam-Swinging) bestimmt werden und Radarreflektivität sowie Turbulenz abgeleitet<br />
werden. Insbesondere in den Sommermonaten liegt das Augenmerk auf der Erfassung von Radarsignaturen<br />
in der Mesosphärenregion, den sogenannten (polaren) mesosphärischen Sommerechos.<br />
Abb. 17.2: Das VHF-Radar OSWIN in Kühlungsborn<br />
Abb. 17.3: Das VHF-Radar MAARSY auf<br />
Andøya<br />
Das OSWIN-Radar in Kühlungsborn (Abb. 17.2) besitzt ein Antennenfeld aus 12 x 12 Yagi-<br />
Antennen in einer quadratischen Gitterstruktur, wobei jeweils 24 Antennen einem der 6 Empfänger<br />
zugeordnet werden. Ein phasengesteuertes Einspeisen des Sendeimpulses in die verschiedenen Antennengruppen<br />
ermöglicht es, den 6 ◦ schmalen Antennenstrahl in bis zu 9 feste Positionen mit einer<br />
Zenitablage von 0 ◦ , 7 ◦ und 14 ◦ zu schwenken. Die maximale Pulsspitzenleistung beträgt 90 kW.<br />
66