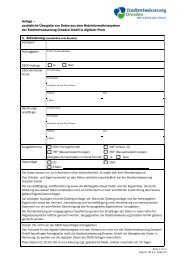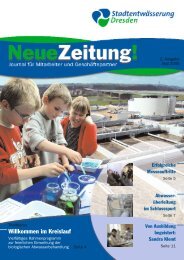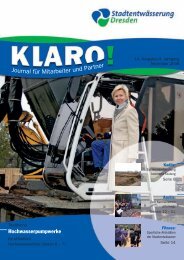Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Letztere sowie die in dieser Chronik mehrmals<br />
genannten Schwierigkeiten <strong>der</strong> Abfuhr <strong>der</strong> Grubeninhalte<br />
waren Missstände, die im krassen<br />
Wi<strong>der</strong>spruch zur Schönheit <strong>der</strong> Barockstadt am<br />
Elbstrom standen.<br />
<strong>Zur</strong> Beräumung <strong>der</strong> Abortgruben bestand zwar<br />
inzwischen die „Dresdner Düngerexport-Actiengesellschaft“[24],<br />
die ihre Tätigkeit gemäß einem<br />
hierzu aufgestellten Regulativ vom 14. Januar<br />
1871 unter Aufsicht <strong>der</strong> Wohlfahrtspolizei besorgte.<br />
Die unhygienischen Verhältnisse <strong>der</strong> Aborte<br />
in den Wohnhäusern waren dadurch aber<br />
noch nicht behoben. Die Gesellschaft schloss mit<br />
<strong>der</strong> Stadt einen bis zum Jahr 1890 gültigen Vertrag<br />
ab, <strong>der</strong> ausschließlich die Gesellschaft zur<br />
Räumung <strong>der</strong> Kloakengruben berechtigte.<br />
Ihr gehörte ein Grundstück am Tatzberg mit ausgedehnten<br />
Stallanlagen, Wagen- und Fassremisen<br />
sowie einen Düngerablageplatz in Klotzsche,<br />
wohin <strong>der</strong> Kot in „Fasslowrys“ per Eisenbahn<br />
transportiert wurde. Von hier aus erfolgte die<br />
Verteilung an die Bauernschaft <strong>der</strong> Umgebung.<br />
Die Düngerexport-Actiengesellschaft verfügte<br />
über 100 Pferde, 400 m Gummischläuche in<br />
Stücken bis 12 m Länge, 60 Jauchewagen, 1.800<br />
Fässer à 0,2 m³, 7 Jauchepumpen, 3 Luftpumpapparate,<br />
12 Eisenbahnlowrys“ sowie 38 Kolonnen-<br />
und Gerätewagen. Obwohl das Königliche<br />
Ministerium des Inneren auf <strong>der</strong> Grundlage eines<br />
am 26. Oktober 1870 abgegebenen Gutachtens<br />
des Landesmedicinalcollegiums die Genehmigung<br />
zur Ergänzung <strong>der</strong> Bauordnung <strong>der</strong><br />
Stadt Dresden bezüglich <strong>der</strong> Errichtung von Wasserklosetts<br />
bereits erteilt hatte, äußerte <strong>der</strong><br />
Stadtbezirksarzt Dr. Niedner in einem Gutachten<br />
vom 10. November 1873 erneut große Bedenken<br />
bezüglich <strong>der</strong>en Einführung.<br />
„<strong>Zur</strong> Vermeidung <strong>der</strong> vielen Schwierigkeiten und<br />
Unzuträglichkeiten, welche für die Stadt Dresden<br />
aus dem längeren Fortbestehen von Watercloseteinrichtungen<br />
notwendig hervorgerufen würden,<br />
den Beschluß zu fassen, von jetzt an die Errichtung<br />
neuer sowie die Weiterbenutzung alter Waterclosets<br />
in Dresden ein für alle Mal zu verbieten, dagegen<br />
ein bestimmt organisiertes Abfuhrsystem<br />
auf städtische Kosten einzuführen.“ [10]<br />
Als Nachteil führte er trotz <strong>der</strong> großen Annehmlichkeiten<br />
<strong>der</strong> WCs, den Verlust des Dungwertes<br />
für die Landwirtschaft bei Abschwemmung <strong>der</strong><br />
Fäkalien in die Elbe an. Für eine Verrieselung <strong>der</strong><br />
Abwässer an <strong>der</strong> Stadtgrenze reichte <strong>der</strong> Platz<br />
nicht aus. Vor allem befürchtete er aber, dass bei<br />
erneuten Cholera- bzw. Typhusepidemien diese<br />
nicht mehr zu beherrschen seien. Wenn <strong>der</strong><br />
Krankheitserreger im Kot durch die Wassertoilette<br />
in die Kanalisation gelange, bestehe keine Möglichkeit<br />
mehr zur Desinfektion dieser Abgänge.<br />
51