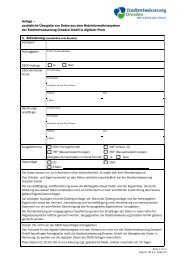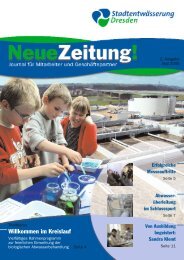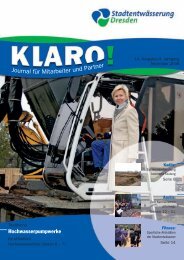Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Zur Geschichte der Stadtentwässerung Dresdens
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
In den Jahren 1922 bis 1930 erfolgte eine Ausweitung<br />
<strong>der</strong> Messstellen auf 19 Stück, verteilt über<br />
die Altstadt und Neustadt. Die in Gruna (1926) und<br />
Kaitz (1930) eingerichteten Regenschreiber standen<br />
in Verbindung mit Abflussbeobachtungen im<br />
Kanalnetz in Gruna bzw. im Kaitzbach. Mit <strong>der</strong> Vorlage<br />
<strong>der</strong> Habilitationsschrift „Die Auswertungen<br />
<strong>der</strong> Dresdner Regenbeobachtungen 1901 bis<br />
1932“ von Stadtamtsbaurat Dr.-Ing. Friedrich Reinhold,<br />
Dresden im Februar 1935, wurde eine wichtige<br />
Grundlage für die Ausarbeitung von deutschlandweiten<br />
Vorschriften zur Bemessung von Kanalisationen<br />
bei Regenereignissen geschaffen. Gegenwärtig<br />
sind wie<strong>der</strong> 17 Regenmessstellen zur Abflusssteuerung<br />
im Kanalnetz in Betrieb.<br />
Hochwasserschutz – eine nicht<br />
zu unterschätzende Aufgabe <strong>der</strong><br />
<strong>Stadtentwässerung</strong><br />
Mit <strong>der</strong> Inbetriebnahme <strong>der</strong> Abfangkanäle und<br />
<strong>der</strong> Hauptpumpstation in Dresden-Kaditz wurde<br />
nicht nur die Grundlage für die Behandlung <strong>der</strong><br />
Abwässer geschaffen, son<strong>der</strong>n als weitere wichtige<br />
Aufgabe auch <strong>der</strong> Hochwasserschutz und die<br />
hygienischen Verhältnisse in den Entwässerungsgebieten<br />
verbessert sowie die Unterhaltungsaufwendungen<br />
für die Kanalisation gesenkt. Im<br />
Gutachten des Reichs-Gesundheitsrathes über<br />
die Einleitung <strong>der</strong> Abwässer <strong>Dresdens</strong> in die<br />
Elbe, vom 8. Februar 1902, wird darauf hingewiesen,<br />
dass beim Ansteigen <strong>der</strong> Elbe „ein mehr<br />
o<strong>der</strong> min<strong>der</strong> großer Teil des Kanalnetzes unter<br />
Stau gesetzt und gewissermaßen in einen stagnierenden<br />
Sumpf umgewandelt wird, <strong>der</strong> nach<br />
Verlaufen <strong>der</strong> Hochflut durch starke Spülungen<br />
und durch Handarbeit wie<strong>der</strong> beseitigt werden<br />
muss.“ Die Rückstauverhältnisse wurden vor<br />
dem Bau <strong>der</strong> Abfangkanäle statistisch erfasst. So<br />
wurde beispielsweise in o. g. Gutachten festgestellt,<br />
dass die Friedrichstädter Hauptschleuse<br />
(<strong>der</strong> heutige Mischwasserkanal Friedrichstraße)<br />
172 Tage pro Jahr „in ihrem Abflusse gestört“<br />
war.<br />
Um 1900 wurde für Dresden ein Entwässerungssystem<br />
konzipiert, das bis zum damals gültigen<br />
HW 100<br />
<strong>der</strong> Elbe von 8,77 m Dresdner Pegel<br />
(Höchster Stand des Elbehochwassers 1845) eine<br />
schadlose Ableitung <strong>der</strong> anfallenden Abflüsse<br />
gewährleistete. Kernbestandteile dieses Entwässerungssystems<br />
waren und sind die rechts und<br />
links <strong>der</strong> Elbe verlegten Abfangkanäle, mittlerweile<br />
91 Hochwasserschieber und das in Dresden-Kaditz<br />
befindliche Hochwasserpumpwerk<br />
mit einer För<strong>der</strong>leistung von bis zu 18 m³/s, dem<br />
maximalen Kanalabfluss.<br />
Es ist ein beson<strong>der</strong>es Merkmal des Dresdner<br />
Entwässerungsnetzes, dass bereits bei geringen<br />
61