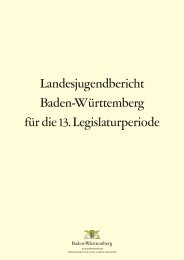Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 125<br />
der jeweiligen theoretischen Ausrichtung und angewendeten Technik, einen erheblichen Teil<br />
zu Therapieerfolgen beitragen. Diese Faktoren sind: die Entwicklung eines plausiblen<br />
Modells zur Erklärung der Problematik, echtes Interesse für den Patienten, Förderung von<br />
Hoffnung beim Patienten und die Anwendung irgendwelcher Techniken (Grawe, 1995).<br />
Hypnose kann alle diese Faktoren in sehr effizienter Weise unterstützen und so deren<br />
Wirksamkeit erhöhen. Mit der Einführung des therapeutischen Tertiums (Unbewußtes) kann<br />
Hypnose plausibel die Entstehung von Problemen (z.B. Ressourcen, die das Unbewußte<br />
bereithält werden nicht genutzt) und dessen Lösung (z.B. Entwicklung und Nutzen der<br />
Ressourcen) erklären. Durch das Ritual der Hypnoseinduktion, entsteht eine enge<br />
therapeutische Beziehung, in der sich der Therapeut auf minimale Reaktionen des<br />
Hypnotisanden konzentriert und diese aufgreift. So erfährt der Patient echtes Interesse und<br />
Einfühlungsvermögen des Therapeuten. Die Hoffnung, daß in Hypnose besondere<br />
Fähigkeiten wirksam werden ist häufig der Grund, warum sich Patienten einer Therapie mit<br />
Hypnose unterziehen wollen und diese Hoffnung wird durch das Erfahren von klassischen<br />
hypnotischen Phänomenen (z.B. Handlevitation, PHA) wirkungsvoll und subjektiv evident<br />
bestätigt. In Anlehnung daran meint Kirsch (2000), daß Plazebos, die zu erstaunlichen<br />
Remissionen bei vielen Krankheiten führen und oft nur unwesentlich weniger wirksam als<br />
aktive Pharmaka sind, und Hypnose gemeinsame Prozesse teilen. In beiden Fällen führt<br />
Suggestion (die im Fall einer Pharmakotherapie sehr direkt erfolgt) zu einer Erhöhung der<br />
Reaktionserwartung, die eng mit einem Therapieerfolg zusammenhängt. So meint auch<br />
Revenstorf (2000b): „Hypnose kann man als effektives Ritual verstehen, um zunächst<br />
unspezifische Wirkfaktoren in der Therapie und Selbstheilungskräfte in einem Ausmaß zu<br />
mobilisieren, wie die Schulmedizin oder Schulpsychologie es nicht kann.“ (S. 3)<br />
Revenstorf (2000c) ist der Ansicht, daß Hypnose auf verschiedenen Ebenen ansetzen kann,<br />
auf einer körperlichen Ebene (Analgesie, Aktivierung des Immunsystems), auf der kognitiven<br />
Ebene (Modulation von Affekt, Kognitionen, Imaginationen) in der Vorbereitung von<br />
Handlungsentwürfen und Interaktionen und auf einer sinngebenden Ebene, welche die<br />
Spiritualität des Individuums berücksichtigt. Auch Verhaltenstherapie setzt zumindest auf den<br />
drei erstgenannten Ebenen an. Es stellt sich somit die Frage, ob es nicht sinnvoller für die<br />
Hypnose ist, in einer allgemeinen Psychotherapie einen Platz zu finden und dann angewendet<br />
zu werden, wenn ihre Stärken auch genutzt werden können. Im Gegensatz zu anderen<br />
Verfahren besteht nämlich für die Hypnose die Möglichkeit einer differentiellen Indikation<br />
zumindest bei einigen Störungsbildern. Die Patienten sollten über eine gewisse<br />
Hypnotisierbarkeit verfügen, damit eine Therapie mit Hypnose Erfolg verspricht. Die<br />
Hypnotisierbarkeit kann mit standardisierten und normierten Skalen erfaßt werden und es gibt<br />
Methoden die Hypnotisierbarkeit zu erhöhen (Edmonston, 1986; Krause, 2000, s. Kap.5.2).<br />
Auf dem Gebiet der differentiellen Indikation ist Hypnose somit schon weiter als andere, von<br />
den Krankenkassen anerkannte, Therapieverfahren. So gibt es bisher keine Skalen zur<br />
„Verhaltenstherapierbarkeit“ oder „Psychoanalysierbarkeit“.<br />
Die klinische Hypnose hat sich über die Jahrhunderte beträchtlich entwickelt und Theorien<br />
darüber, was Hypnose ist, wurden immer schon vom jeweiligen Zeitgeist bestimmt (zur<br />
Geschichte der Hypnose s. z.B. Meinhold, 1996; Peter, 2000c, 2000d). Bongartz und<br />
Bongartz (1998) kommen zu dem Schluß, daß die Entwicklung in den letzten 30 Jahren, weg<br />
von der klassischen Hypnose als symptomorientierte Suggestivtherapie in Trance, hin zu einer<br />
emotionalen Therapie in Trance, gekennzeichnet ist. Emotionale Therapie in Trance ist ein<br />
weitgefaßter Begriff, unter dem sich inzwischen eine Vielzahl von Techniken und Ansätzen<br />
subsummieren, die keine formale Hypnoseinduktion verwenden, mit dem Hinweis spontane<br />
Trancezustände einer Person zu erzeugen und zu nutzen. Diese Auffassung deckt sich zwar<br />
teilweise mit empirischen Ergebnissen, die belegen, daß alle hypnotischen Phänomene auch<br />
ohne explizite Trance auftreten können (Hull, 1933; Barber, 1969), ist meiner Auffassung<br />
nach aber ein zu weit gefaßter Trancebegriff. Damit macht es sich die klinische Hypnose nur