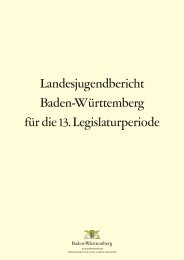Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 140<br />
Unwillkürlichkeit. Gearan, Schoenberger und Kirsch (1995) sind dagegen der Meinung,<br />
daß Pbn das Gefühl der Leichtigkeit erst über Imaginationen in subjektiv evidenter Weise<br />
erfahren müssen, um die Reaktion dann auch wirklich unwillkürlich zu erleben. In ihrer<br />
Modifikation des CSTP, werden alle Aufforderungen zu willkürlichen Reaktionen<br />
unterlassen, was ebenfalls eine aktive Haltung Suggestionen zu interpretieren fördert. Ihre<br />
Pbn jedoch zeigen bei Reaktionen auf Suggestionen weniger Compliance (bewußt,<br />
willentliche Ausführung der Suggestionen) als in der Orginalversion des Trainings.<br />
• Sensorische Deprivation führt zu einer besseren Hypnotisierbarkeit. Barabasz (1982)<br />
belegte dies unter Anwendung der REST (Restricted Environmental Stimulation<br />
Technique) experimentell, aber auch anhand einer Gruppe von Forschern in der Antarktis<br />
(Barabasz, 1990). Die Ausschaltung von Außenreizen während der Induktion kann auch<br />
schon als eine gewisse Form der sensorischen Deprivierung angesehen werden. Bernheim<br />
(1884) berichtete, daß er im Krankenhaus (geringe sensorische Stimulation) Klienten<br />
leichter in eine Trance versetzen konnte als zu Hause in seiner Praxis.<br />
• In einer anderen Studie führt alleine die Definition der Situation als Hypnose, in einer<br />
zweiten Messung der Hypnotisierbarkeit, zu hohen Werten bei Hochhypnotisierbaren,<br />
während Niedrighypnotisierbare schlechter abschneiden. Dieser Effekt dreht sich jedoch<br />
um, wenn der zweite Test als kreativer Vorstellungstest angekündigt wird (Spanos et al.,<br />
1989). Die Effektivität einer Intervention bei niedrighypnotisierbaren Klienten kann also<br />
optimiert werden, wenn Hypnose als Vorstellungsübung deklariert wird, bei<br />
Hochhypnotisierbaren empfiehlt sich das Label „Hypnose“. Diese Variable scheint direkt<br />
auf die Reaktionserwartungen, aber auch auf die interpersonelle Beziehung zu wirken.<br />
• Die Variable Prestige des Hypnotiseurs stellt ebenfalls eine Kontextvariable dar und wirkt<br />
über Einstellungen, Reaktionserwartungen und Motivation auf die hypnotische<br />
Reaktionsbereitschaft. Ein vermeintlich hoher Status des Hypnotiseurs führt zu höheren<br />
Werten der Hypnotisierbarkeit (Small & Kramer, 1969) bzw. zu einer tieferen Trance<br />
(Godeby et al., 1993).<br />
• Kennzeichen der Induktion können die Hypnotisierbarkeit unter Umständen ebenfalls<br />
beeinflussen. Laut Rossi (1980) ist die Zeit, die Klienten brauchen, einen Trancezustand<br />
zu erreichen sehr unterschiedlich. Er betont, daß M.H. Erickson an experimentellen<br />
Untersuchungen öfter die zu knappe Zeit kritisiert hat, die aufgewendet wurde, um Pbn in<br />
Trance zu versetzen. Dieser kann nämlich individuell erheblich variieren und sich mit<br />
zunehmender Übung verändern. Eine formale Hypnoseinduktion ist weder eine<br />
notwendige noch hinreichende Voraussetzung für Verhalten, das mit Hypnoseskalen<br />
erfaßt wird. Auch aufgabenmotivierende Instruktionen können Hypnose erzeugen (Barber,<br />
1969). Genauso geben Personen, denen gesagt wird, sie sollen sich selbst in Trance<br />
versetzen, ein ganz ähnliches Bild ab, wie solche, die eine formale Hypnoseinduktion<br />
durchlaufen. Lynn, Neufeld und Mare (1993) kommen nach einer Literaturdurchsicht zu<br />
dem Schluß, daß es keine Unterschiede zwischen direkten und indirekten<br />
Induktionsverfahren in der Auswirkung auf die Hypnotisierbarkeit gibt. Dazu muß<br />
allerdings kritisch angemerkt werden, daß die zitierten Studien lediglich Hypnoseskalen<br />
wie die SHSS:A verwenden, die in eine permissivere Sprache umformuliert wurden.<br />
Szabo (1996) findet dagegen, daß Pbn mit niedriger und mittlerer Hypnotisierbarkeit<br />
besser auf indirekte, Hochhypnotisierbare dagegen sowohl auf direkte als auch auf<br />
indirekte Suggestionen ansprechen.<br />
• Schon in Kap. 5.1 wurde betont, daß die Beziehung zwischen Hypnotisand und<br />
Hypnotiseur vielleicht die einzige Variable ist, mit der sich Hypnose von anderen<br />
Trancezuständen unterscheidet. Man kann die Induktion als Möglichkeit für Therapeuten<br />
und Klienten sehen, einen Rapport auszubilden. Indem der Hypnotiseur minimalen<br />
Hinweisreizen des Klienten folgt (Pacing), ihm in dessen Weltmodell begegnet und es für<br />
die Induktion benutzt (Utilisation), können sich Einstellungen, Reaktionserwartungen und