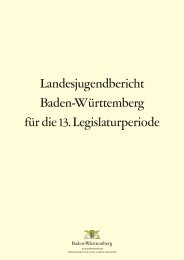Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 138<br />
Erwähnenswert ist, daß sich die Hypnotisierbarkeit auch mit der Tageszeit und dem<br />
Lebensalter verändert. So erreicht sie für „Frühaufsteher“ um 10 Uhr und 14 Uhr einen<br />
Höhepunkt, für „Nachtmenschen“ um 13 Uhr und zwischen 18 und 21 Uhr (Wallace, 1993;<br />
Wallace & Kokoszka, 1995). Kinder sind zwischen 9 und 12 Jahren besonders empfänglich<br />
für Hypnose, mit zunehmendem Alter sinkt die Hypnotisierbarkeit langsam ab (Morgan &<br />
Hilgard, 1973).<br />
Die Annahme, daß Hypnotisierbarkeit eine überdauernde Eigenschaft ist, stützt sich auf<br />
Erhebungen anhand von Zwillingen (Morgan & Hilgard, 1973). Außerdem konnte eine<br />
Stabilität der Hypnotisierbarkeit über 25 Jahre hinweg nachgewiesen werden (Piccione,<br />
Hilgard & Zimbardo, 1989).<br />
Dennoch gibt es viele Belege dafür, daß Hypnotisierbarkeit veränderbar ist. Einfluß auf die<br />
Testwerte einer Person haben sowohl situative und kontextabhängige Variablen, aber auch<br />
eher überdauernde Eigenschaften, die in einer Hypnosesitzung jedoch kaum unabhängig<br />
voneinander wirken und großenteils miteinander kovariieren. Sie bieten durchaus<br />
Anhaltspunkte, mit welchen Maßnahmen die Empfänglichkeit für Hypnose bei<br />
niedrigsuggestiblen Klienten erhöhen werden kann.<br />
Wie schon erwähnt, konnte bisher kein Zusammenhang mit gängigen<br />
Persönlichkeitsvariablen gefunden werden. Allein im kognitiv-imaginativen Bereich gibt es<br />
ein paar Variablen, die mit der Hypnotisierbarkeit korrelieren:<br />
• Absorption: Am eindeutigsten und durchgängigsten wurden Korrelationen mit der<br />
Tellegen Absorption Scale (TAS, Tellegen & Atkinson, 1974) erzielt. Absorption kann als<br />
völlige Involviertheit in imaginative Aktivität definiert werden. Die meisten Studien<br />
bestätigen einen mäßigen, aber signifikanten Zusammenhang mit Hypnotisierbarkeit (z.B.<br />
De Pascalis, 2000). Positive Auswirkungen der Fähigkeit zur Absorption auf dissoziative<br />
Erfahrungen wurden diskutiert, die Hinweise aus einer Studie von Barrett (1996) können<br />
diese Annahme aber nicht bestätigen.<br />
• Dissoziation: Die Beziehung von dissoziativen Störungen zur Hypnotisierbarkeit wurde<br />
oben beschrieben (s. Kap. 3.10, Kap. 4.7.6). Besonders für die Erfahrung von<br />
Unwillkürlichkeit in Hypnose sind dissoziative Erfahrungen besonders überzeugend.<br />
Dissoziation wird auch als komplementäres Phänomen zu Absorption beschrieben (Butler<br />
et al., 1996).<br />
• Die Veranlagung, Tagträumen nachzugehen und paranormale Erfahrungen zu machen<br />
(fantasy proneness) kann die Hypnotisierbarkeit ebenfalls vorhersagen und ist dabei eine<br />
Variable, die weniger kontextabhängig zu sein scheint als die anderen (Kirsch & Council,<br />
1992).<br />
• Kontextabhängige Effekte ergeben auch für Zusammenhänge zwischen Hypnotisierbarkeit<br />
und der Lebhaftigkeit von Vorstellungen (imagery vividness). Eine Reihe von anderen<br />
Konzepten, die alle mit Imagination zu tun haben, werden ebenfalls in Beziehung zur<br />
Hypnotisierbarkeit gesetzt (s. Kunzendorf, 1985/1986). De Pascalis (2000) fand zwar<br />
niedrige aber signifikante Korrelationen der Betts‘ Mental Imagery Scale mit<br />
Hypnotisierbarkeit. Eine Regressionsanalyse zeigte jedoch daß die Skala keinen guten<br />
Prädiktor für Hypnotisierbarkeit darstellte.<br />
• kognitive Flexibilität: Hochhypnotisierbare können schneller ihren Bewußtseinszustand<br />
verändern und besser von analytischen, detailorientierten kognitiven Strategien auf<br />
holistische, imaginative Strategien umschalten (Crawford, 1989, 1996). Ungeklärt bleibt<br />
in wieweit diese Flexibilität stabil ist. Diese größere Flexibilität läßt sich mit<br />
physiologischen Meßverfahren (EEG, PET, SPECT) nachweisen (s. Kap. 5.1)