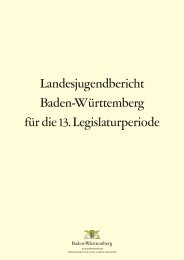Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 93<br />
lebensrettend sein, z.B. wenn eine Person sich selbst oder andere nach einer Katastrophe<br />
in Sicherheit bringt. Der Automatismus tritt in Situationen wiederholten Mißbrauchs ein,<br />
so daß das Opfer den Anforderungen des Täters Folge leisten kann ohne sich dabei völlig<br />
bewußt zu werden, was es tut.<br />
• Abspaltung: Bei dieser Form der Abwehr werden Gedächtnisinhalte von anderen<br />
abgetrennt. Die Abwehr kann als eine fehlgeschlagene Integration von Erfahrung und<br />
Wissen gesehen werden. In Kap. 3.1 wurden Beispiele zum zustandsabhängigen oder<br />
kontextabhängigen Gedächtnis genannt, die in diese Kategorie eingeordnet werden<br />
können. So können überwältigende Affekte und Erinnerungen isoliert werden. Die Person<br />
kann auf diese Weise schmerzhafte kognitive Dissonanz, das eigene Selbstbild betreffend,<br />
vermeiden. Ein mißbrauchtes Kind kann so wissen, daß es von einem Elternteil<br />
mißhandelt wurde, gleichzeitig aber diesen Elternteil idealisieren. Oft kommt es jedoch zu<br />
Intrusionen von abgespaltenen Gedächtnisinhalten in Form von Flashbacks.<br />
• Veränderung der Identität und Selbstentfremdung: Das sind die Hauptsymptome<br />
pathologischer Dissoziation (s.o.). Der Mechanismus soll eine Person vor psychologisch<br />
inakzeptablen Erfahrungen beschützen.<br />
Traumatischer Streß kann Amnesie, auch über andere Mechanismen als Verdrängung<br />
induzieren, obwohl Feld- und auch Laborstudien nahelegen, daß eher die Erinnerung an<br />
periphere, als die an zentrale Aspekte der Erfahrung verloren geht (s. Übersicht bei<br />
Christianson, 1992; Putnam, 1997). Selten besteht Amnesie für das gesamte traumatische<br />
Ereignis. Die populärste Erklärung dieser Art von Gedächtnisverlust erfolgt durch das<br />
Yerkes-Dodson-Gesetz (Yerkes & Dodson, 1908) oder die Weiterentwicklung desselben, der<br />
Easterbrook-Cue-Utilisations-Hypothese (Easterbrook, 1959). Nach Yerkes und Dodson<br />
kommt es bei einem mittleren Erregungsniveau zur besten (Gedächtnis)Leistung. Darüber<br />
hinaus ansteigende Erregung verringert progressiv das Ausmaß der Aufmerksamkeit, das auf<br />
ein Ereignis gelenkt wird. So kommt es, daß zuerst die Verarbeitung peripherer und dann<br />
zentraler Prozesse verhindert wird (Easterbrook, 1959). Auf jeden Fall verringert sehr hohe<br />
Erregung die Ressourcen zur Informationsverarbeitung zum Zeitpunkt des Kodierens, was zu<br />
einem überdauernden Gedächtnisdefizit führt. Paradox ist der Effekt, daß ein hohes<br />
Erregungsniveau zwar zu einer unmittelbaren Beeinträchtigung des Gedächtnisses führt, nach<br />
einem längeren Behaltensintervall, aber zur Reminiszens, also einer Erinnerung von Inhalten,<br />
die zuvor nicht abgerufen werden konnten (Revelle & Loftus, 1992).<br />
Nicht nur Angst, sondern auch andere emotionale Zustände wie z.B. Depressionen können<br />
funktionelle Amnesien hervorrufen. Auch in diesem Fall wird ein Kodierungsdefizit aufgrund<br />
von mangelnden Aufmerksamkeitsressourcen als Ursache angenommen. Solche Effekte<br />
wären natürlich ebenfalls überdauernd und nicht reversibel. Eine andere Erklärung für<br />
emotional induzierte Amnesien wäre das stimmungsabhängige Gedächtnis (z.B. Bower, 1981;<br />
s. Kap. 3.1). Gedächtnisinhalte, die in einer Stimmung (Traurigkeit) erworben wurden, sind<br />
zugänglicher, wenn der Abruf in der gleichen Stimmung erfolgt.<br />
Sowohl das Erregungsniveau, als auch Emotionen stellen das Ergebnis psychobiologischer<br />
Prozesse dar, die das Gedächtnis mehr oder weniger direkt beeinflussen. Es soll hier darauf<br />
hingewiesen werden, daß viele Episoden funktioneller Amnesien durch eine Hirnverletzung<br />
ausgelöst werden. Kihlstrom und Schacter (1995) betonen, daß es neuere Ergebnisse gibt, die<br />
zeigen, daß bei Patienten mit DIS Veränderungen der Organisation im Gehirn und auch<br />
Veränderungen neurochemischer Abläufe zu beobachten sind, welche die Identitätswechsel<br />
begleiten. Diese Erkenntnisse werfen die Frage auf, was mit dem Label funktionell, in<br />
Abgrenzung zu strukturellen (organischen) Amnesien, bezeichnet werden kann.<br />
Einmal wird formal neurologisch zwischen strukturell oder anatomischen und funktionell<br />
oder physiologischen Veränderungen unterschieden. Diese Unterscheidung bezieht sich auf