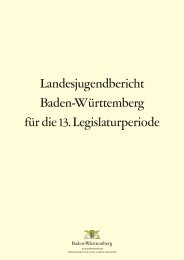Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 69<br />
So haben traumatische Erfahrungen explizite, aber auch prozedurale Anteile. Bei der<br />
Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) z.B. erinnern sich die Patienten genau an<br />
sensorische, affektive Komponenten des Traumas, während sie für andere Aspekte amnestisch<br />
sein können und über diese auch keine symbolische Repräsentation verfügen (s. Kap. 4.6).<br />
Verdrängung ist nicht unbedingt ein pathologischer Prozeß. Laut Haley (1976) kann er<br />
adaptiv sein und Symptome reduzieren. Er spricht sich für eine vorsichtige Anwendung von<br />
Amnesie in der Psychotherapie aus, da es förderlich sein kann, einer Person zu helfen Ideen<br />
vor sich selbst zu verbergen. Erdelyi (1990) ist der Ansicht, daß Verdrängung sowohl<br />
Symptome erzeugen, als auch lindern kann.<br />
Rekonstruktive Prozesse können nach Erdelyi (1990) ebenfalls Abwehrfunktion haben,<br />
brauchen das jedoch, wie Verdrängung auch, nicht zwangsläufig. Wird eine Geschichte<br />
nacherzählt, werden nach Bartlett (1932) Schemata aktiv, deren sich die Person nicht bewußt<br />
ist. Teile der Geschichten werden beim Nacherzählen ausgelassen, zwei Darsteller einer<br />
Geschichte können zu einem verschmelzen, eine Handlung kann nacherzählt, die Motive<br />
jedoch durch den Nacherzählenden hinzugefügt werden. Freuds Abwehrmechanismen äußern<br />
sich auf jeden Fall in den Schemata, die eine Person verwendet, um Inhalte aus dem<br />
Gedächtnis zu rekonstruieren. Während Bartlett in der Beschreibung der Schemata die<br />
kognitiven Anteile betont, steht für Feud die Abwehr von emotionsgeladenen Inhalten im<br />
Vordergrund. Das ist nach Erdelyi jedoch kein Widerspruch und er meint, daß alle<br />
Abwehrmechanismen (z.B. Verleugnung, Projektion, Sublimierung) in rekonstruktiven<br />
Prozessen zum Ausdruck kommen (s. Kap. 3.8, Kap. 3.9).<br />
Dissoziation<br />
Während Freud zumindest zu Beginn nicht zwischen Dissoziation und Verdrängung<br />
unterschied, wird heutzutage zwischen den Begriffen unterschieden, besonders von Autoren,<br />
die sich intensiver mit Hypnoseforschung befassen. Janet (1907) sah Dissoziation als einen<br />
Abwehrmechanismus, während Kihlstrom und Hoyt (1990) Dissoziation nicht als Abwehr<br />
sehen und Verdrängung als eine Variante der Dissoziation auffassen. Nach Spiegel, Hunt und<br />
Dondershine (1988) kann Dissoziation in manchen Situationen neutral sein, in anderen<br />
Situationen jedoch die Funktion eines Abwehrmechanismusses einnehmen. Sie fanden, daß es<br />
eine signifikante Korrrelation zwischen der Hypnotisierbarkeit von Vietnam Veteranen und<br />
Sypmptomen der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTSD) gab. Diese Befunde legen<br />
nahe, daß Dissoziation eine Abwehrfunktion während eines Traumas haben kann, die es einer<br />
Person erlauben kann, schmerzhafte Erfahrungen so zu erleben, als würden sie einem anderen<br />
Selbst widerfahren. Die Symptome der PTSD weisen eine starke dissoziative Komponente auf<br />
(s. Kap. 4.6), genauso wie das Erleben von klassischen hypnotischen Phänomenen. In<br />
Hypnose stellt Dissoziation eine Folge intensiver Absorption dar (Kap. 5.2).<br />
Spiegel (1990) meint, daß Dissoziation am deutlichsten anhand des Krankheitsbilds der<br />
Dissoziativen Identitätsstörung wird. Gewisse Informationseinheiten werden unabhängig von<br />
anderen verarbeitet und gespeichert. Die Stimulation einer Identität führt dazu, daß gewisse<br />
Informationssets aktiviert, andere gehemmt werden (s. Kap. 4.5). Ein anderes Beispiel dafür<br />
wie Inhalte und Affekt zusammen gespeichert und abgerufen werden, ist das<br />
zustandsabhängige Gedächtnis (z.B. Bower, 1981; s. Kap. 3.2). Dissoziation kann als ein<br />
Modell gelten, um eine unbewußte Interaktion dissoziierter Einheiten oder Systeme des<br />
Organismus zu verstehen. Mehrere Systeme können, scheinbar unabhängig voneinander,<br />
wirksam sein, wie in einer hypnotischen Trance, wenn sich bei der Handlevitation eine Hand<br />
anscheinend unwillkürlich und ohne bewußtes Zutun hebt. Veränderte Empfindungen, wie<br />
Steifheit, Taubheit und eine gewisse Leichtigkeit lassen die levitierte Hand in einer anderen<br />
Beziehung zum restlichen Organismus stehen, als würden zwei getrennte somatische und<br />
motorische Systeme simultan aktiv sein. In einem Zustand der Fugue oder der Dissoziativen<br />
Identitätsstörung ist diese Dissoziation komplexer und umfaßt neben somatischen und