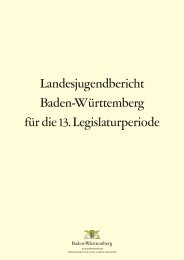Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 146<br />
Schoenberger (2000) resümiert jedoch, daß nur eine Studie zur Gewichtabnahme (Bolocofsky<br />
et al., 1985) die Kriterien „möglicherweise Effektiv“ von Chambless und Hollon (1998)<br />
erfüllt. Alle anderen Studien, die die Wirksamkeit von Hypnose als Adjunkt zu kognitivbehavioralen<br />
Therapien überprüfen entsprechen nicht den neueren, streng angelegten<br />
Kriterien (s.o.). Eine weitere Studie fand, daß Hypnose die Effektivität einer kognitivbehavioralen<br />
Therapie erhöht. Hier wurde eine Hypnoseinduktion und Suggestionen anstatt<br />
von Entspannung angewandt. Beide Gruppen konnten Ihre Sprechangst im Vergleich zu einer<br />
unbehandelten Kontrollgruppe reduzieren, wenn das Ausmaß der Angst subjektiv beschrieben<br />
wurde, jedoch nur die Hypnosegruppe war besser als die Kontrollgruppe, wenn subjektiveund<br />
Verhaltensmaße während einer Stehgreifrede erhoben wurden (Schoenberger et al.,<br />
1997). Hier besteht eindeutig Forschungsbedarf in Hinsicht auf moderne methodische<br />
Kriterien, um zu zeigen, daß Hypnose die Effektivität kognitiv-behavioraler Therapien<br />
erhöhen kann.<br />
Montgomery et al. (2000) beurteilen Hypnose, indem sie die Kriterien von Chambless und<br />
Hollon (1998) heranziehen, als eine Therapieform, deren Effektivität sowohl bei akutem als<br />
auch bei chronischem Schmerz gut nachgewiesen ist. 18 Studien, die anhand von 933<br />
Patienten durchgeführt wurden gingen mit 27 Effektgrößen in die Metaanalyse ein. Die<br />
ermittelte Effektstärke nach Cohen (1992) betrug d = .74 und entspricht einem mittleren bis<br />
großen Effekt. Der durchschnittliche mit Hypnose behandelte Patient schnitt besser ab als 75<br />
% der Pbn, die eine Standardprozedur zur Analgesie oder keine Behandlung bekamen. Die<br />
Effektstärken von klinischer und experimenteller Analgesie unterschieden sich kaum.<br />
Hochhypnotisierbare Pbn profitierten signifikant mehr als niedrig-, jedoch nicht mehr als<br />
mittelhypnotisierbare Pbn. (s. Kap. 5.2).<br />
Wie die vier zitierten Metaanalysen zeigen, ist Hypnose eine erfolgreiche Therapiemethode,<br />
sowohl wenn man mit Hypnose behandelte Patienten mit unbehandelten vergleicht als auch<br />
wenn man kognitiv-behaviorale Therapien in Hypnose durchführt. Eine ältere Metaanalyse<br />
von Smith, Glass und Miller (1980) legt nahe, daß sich nicht nur der Effekt von kognitivbehavioralen,<br />
sondern auch der Effekt von psychodynamischen Therapien mit Hypnose<br />
potenzieren läßt. Dabei ist natürlich zu bedenken, daß die Forschungspolitik, bzw.<br />
Herausgeberpolitik von Fachzeitschriften dazu führt, daß Studien, die einen signifikanten<br />
Effekt finden, häufiger zur Publikation eingereicht und auch veröffentlicht werden als<br />
Ergebnisse von Studien, die keinen Effekt nachweisen konnten. Letztere verschwinden oft<br />
einfach in den Schubladen der Forscher. Insofern ist davon auszugehen, daß Metaanalysen<br />
einen zu hohen Effekt der untersuchten Wirksamkeit berichten.<br />
Ein Kritikpunkt an den Studien ist, daß die Methoden in den verschiedenen Studien oft<br />
schlecht beschrieben und sehr heterogen sind. Viele der, in die Metaanalyse von Rominger<br />
(1995) eingegangenen Studien, wenden v.a. kognitiv-behaviorale Techniken an (s. Lynn et al.,<br />
2000). Im Falle der Behandlung von Prüfungsangst wendet eine Studie lediglich eine<br />
Entspannungshypnose an, eine zweite verwendet Minimalsuggestionen (z.B. „Entspannung<br />
ist der Antagonist von Angst“), zwei verwenden ein Verfahren, das im wesentlichen einer<br />
Desensibilisierung in sensu entspricht und weitere zwei eine Reizkonfrontation in sensu. Die<br />
Studie von Kirsch et al. (1995) zeigt, daß Hypnose zumindest als Hefe (Revenstorf, 2000c)<br />
einer Therapie sehr zuträglich ist, auch wenn Schoenberger (2000) noch Forschungsbedarf<br />
sieht, wenn Hypnose als Adjunkt zu kognitiv-behavioralen Therapien eingesetzt wird.<br />
Damit schließt sich der Kreis und es stellt sich wiederum die Frage, wie sich klinische<br />
Hypnose von anderen Therapieformen abgrenzen möchte, angesichts der angestrebten<br />
Kassenzulassung. Es gibt noch zu wenige Studien, die den strengen methodischen<br />
Anforderungen, die von Chambless und Hollon (1998) aufgestellt wurden, genügen und die<br />
Wirksamkeit genuin hypnotischer Techniken nachweisen (Lynn et al., 2000). Allerdings kann<br />
diese Lücke durch relativ wenige, sorgfältig geplante und stringent durchgeführte Studien<br />
bald geschlossen werden. Revenstorf (1999) nennt grundlegende hypnotische Techniken, die