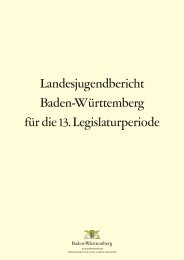Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 57<br />
Items, deren Positionen weit auseinander liegen, so daß die Assoziationen zwischen den Items<br />
gestärkt werden. Wird ein Item erinnert, wird es zum Cue für die Erinnerung des nächsten<br />
Items. Durch die stärkere Assoziation von Items, die zusammen im KZG waren, werden diese<br />
eher wiedergegeben als Items, die wenig oder keine Zeit zusammen im KZG verbracht haben.<br />
Da Items, die sich noch im KZG befinden, zuerst produziert werden, ist der Lag-Recency-<br />
Effekt für frühere Outputpositionen größer als für spätere, die aus dem LZG abgerufen<br />
werden müssen. Dort besteht ein Wettbewerb um die Wiedergabe mit allen anderen Items, die<br />
mit dem gleichen Cue assoziiert sind (s. auch Kap. 3.4).<br />
Die Theorie der temporalen Distinktivität (Murdock, 1960) ist eine Theorie, die das<br />
Phänomen Langzeit-Recency erklären zu versucht. Sie postuliert, daß beim Lernen einer Liste<br />
eine Gedächtnisspur ausgebildet wird, die mit der Zeit schwächer wird. Wird eine<br />
Distraktoraufgabe gegeben, so haben alle Items der Liste eine schwächere Gedächtnisspur als<br />
bei unmittelbarer Erinnerung. Wird nach jedem Item eine Distraktoraufgabe dargeboten, so ist<br />
die Stärke der Spur für das letzte Item gleich stark wie die Spur des letzten Items in der<br />
Bedingung der verzögerten Wiedergabe, in welcher lediglich nach dem letzten Item eine<br />
Distraktoraufgabe enthalten ist. Jedoch sind im ersten Fall die Spuren für die anderen Items<br />
schwächer als im Fall der verzögerten Wiedergabe. Das letzte Item wird sich deshalb im<br />
Wettbewerb um den Abruf gegenüber den anderen Items eher durchsetzen und es kommt im<br />
ersten Fall zu einem Recency-Effekt im zweiten Fall nicht.<br />
Auch Mensink und Raaijmakers (1988) nehmen einen variablen Kontext an, der sensitiv für<br />
das Verstreichen von Zeit ist. Er ist Teil des Abrufs von Information aus dem LZG und<br />
fluktuiert über die Zeit hinweg. Wird ein Item erinnert, so wird der Kontext zum Zeitpunkt,<br />
als das Item kodiert wurde, ebenfalls abgerufen. Dieser weist starke Überschneidungen mit<br />
Items aus benachbarten Positionen auf, so daß er einen effektiven Cue für deren Abruf<br />
darstellt. Parallelen zu dem Konzept der Stärke von Gedächtnisspuren, das zuvor beschrieben<br />
wurde, werden deutlich. Howard und Kahana (1999) sind überzeugt, daß der Recency-Effekt<br />
der seriellen Positionskurve, wie sie typischerweise bei der freien Wiedergabe beobachtet<br />
wird, auf die Wahrscheinlichkeit der ersten Wiedergabe (diese ist für später dargebotene<br />
Items größer) und den Lag-Recency-Effekt (Items aus benachbarten Positionen werden besser<br />
erinnert), zurückgeht.<br />
3.8 Mechanismen oder Quellen für Ungenauigkeit oder Verzerrungen von<br />
Gedächtnisinhalten<br />
Das kognitive System erhält Eingänge aus mehreren Quellen. Das einfachste<br />
Unterscheidungskriterium differenziert zwischen Information, die internal generiert wird<br />
(Gedanken, Vorstellung, Verhalten und Träume) und solcher, die aus der äußeren Welt<br />
stammt. Feinere Unterscheidungen enthalten etwa die Diskrimination zwischen mehreren<br />
externalen Quellen (z.B. „Hat mir das Angelika oder Monika erzählt?“) oder zwischen<br />
inneren Quellen eines erinnerten Ereignisses (z.B. „Habe ich das wirklich gesagt oder wollte<br />
ich das nur sagen“). Die Bedingungen oder die Umstände unter denen ein Gedächtnisinhalt<br />
erworben wurde schließen evaluative und attributionale Prozesse mit ein, Inferenzen, die für<br />
die abgerufene Information bedeutsam sind (Johnson, Hashtroudi & Lindsay, 1993). Diese<br />
Prozesse, die sowohl von internalen als auch von externalen Cues beeinflußt werden, beruhen<br />
auf der Tatsache, daß Erinnerungen aus verschiedenen Quellen unterschiedliche qualitative<br />
Merkmale aufweisen. So enthält das Gedächtnis für Wahrnehmungen aus der äußeren Welt<br />
viele perzeptuelle Details (z.B. Farben, Geräusche), Kontextinformation (z.B. Details, die Zeit<br />
und Ort spezifizieren) und semantische Information. Gedächtnisinhalte, die aus internalen<br />
Quellen stammen, enthalten dagegen eher Informationen über die kognitive Umgebung einer<br />
Person zum Zeitpunkt des Ereignisses, warum oder wann jemand gewisse Dinge