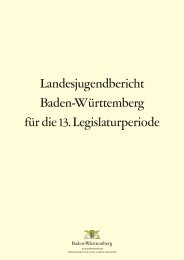Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 29<br />
P3 (NEGATION, P2)<br />
P4 (INTENTION, P3, P1)<br />
Mit den aufgeführten Regeln kann ein ganzer Text in Propositionen aufgegliedert werden,<br />
diese geben die semantische Struktur des Textes wieder, seine Textbasis (Kintch, 1974). Ein<br />
weiteres Prinzip zur Strukturbildung ist die Hierarchie. Ein Text unterscheidet sich gegenüber<br />
einer zufälligen Anhäufung von Wörtern, indem er ein kohärentes (zusammenhängendes)<br />
Ganzes ist. Der Text bildet ein Netzwerk semantischer Einheiten, die alle so miteinander<br />
verknüpft sind, daß kein Element unverbunden bleibt (Grabowski, 1991).<br />
Kohärenz kann nach Kintsch (1974) durch zwei Mittel entstehen: durch<br />
Argumentüberlappung, bei der eine Proposition ein Argument mit einer anderen Proposition<br />
gemeinsam hat (s. Bsp. 7) und durch Einbettung, bei der eine ganze Proposition in einer<br />
anderen als Argument wiederholt wird (s. Bsp. 5). Der Kohärenzgraph eines Textes expliziert<br />
die Verbindungen zwischen den am Text beteiligten Propositionen und bringt dessen<br />
hierarchische Struktur zum Ausdruck.<br />
In mehreren Studien konnte gezeigt werden, daß Propositionen für die semantisch-kognitive<br />
Verarbeitung tatsächlich relevant sind. Indem Sätze gebildet werden, die identische<br />
linguistische Oberflächenmerkmale haben, sich jedoch aufgrund ihrer propositionalen<br />
Struktur unterscheiden, kann differenziert werden, ob bestimmte Kriterien eher mit<br />
propositionalen Parametern einhergehen als mit Merkmalen der sprachlichen Oberfläche. Ist<br />
das der Fall, so scheinen Propositionen über eine gewisse psychologische Relevanz zu<br />
verfügen. Engelkamp (1973) konnte zeigen, daß Sätze, die sich aus zwei Propositionen<br />
zusammensetzen, schlechter behalten werden als Sätze, die nur eine Proposition bilden,<br />
obwohl beide über die gleiche Oberflächenstruktur (gleiche Anzahl von Wörtern) verfügen.<br />
Auch die Lesezeit von Sätzen steigt mit der Anzahl ihrer Propositionen; wiederum bei<br />
gleicher Anzahl von Wörtern (Kintsch & Keenan, 1973). In Sätzen, die aus mehreren<br />
Propositionen bestehen, sind für die Wiedergabe der Inhalte einzelner Propositionen<br />
diejenigen Wörter, die zu derselben Proposition gehören, die effektiveren Cues für den Abruf<br />
als Wörter aus anderen Propositionen desselben Satzes (Anderson & Bower, 1973). Auch im<br />
Fall von semantischem Priming konnten Ratcliff & McKoon (1978) nachweisen, daß es sich<br />
bei Propositionen offenbar um Einheiten handelt, die assoziativ miteinander verbunden sind.<br />
Ihre Pbn entschieden schneller, daß ein dargebotenes Wort in einem zuvor gelernten Satz<br />
vorkam, wenn das vorher dargebotene Wort zur selben Proposition gehörte wie das Zielwort.<br />
Kintsch (1974) stellte weiterhin fest, daß Propositionen dann besser behalten werden, wenn<br />
sie mit anderen Propositionen vernetzt sind. Beyer (1987) konnte einen Hierarchieeffekt bei<br />
längeren Texten (mehr als 50 Propositionen) aufzeigen. Die Wiedergabe für hierarchisch hoch<br />
stehende Propositionen ist dabei wesentlich besser als für hierarchisch niedriger stehende.<br />
Auch werden erstere länger behalten.<br />
Die Konzeption eines propositional-amodalen Gedächtnis als Basis für Sprachverständnis und<br />
-produktion sowie als Basis für Denk- und Entscheidungsprozesse, wurde jedoch auch<br />
kritisiert. Dörner (1997) findet, daß: „...die Annahme eines solchen Gedächtnis schlecht<br />
begründet ist“ und weiter: „...die Annahme eines amodalen Gedächtnis, als Gedächtnis für<br />
begriffliche Relationen [ist] unnötig, da sich solche begrifflichen Relationen auch schon in<br />
einem modalen Gedächtnis auffinden lassen“ (S. 172). Im Gegensatz zu Dörner, der das<br />
gesamte Konzept als unnötig betrachtet, übt Grabowski (1991) eher inhaltliche Kritik. Dabei<br />
findet er, daß der propositonale Ansatz gravierende Schwachstellen und Inkonsistenzen<br />
enthält. Auch in der Anwendung bei der Überprüfung von Behaltensleistungen von längeren<br />
Texten sieht er Schwächen. Wenn Pbn gelesene Texte reproduzieren, so haben die<br />
Reproduktionen auf der sprachlichen Oberfläche oft wenig mit dem Orginaltext gemein.