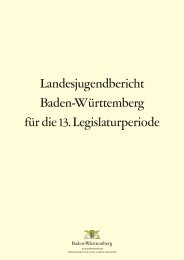Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 19<br />
subliminal dargeboten worden war, die andere aber neu war, so wählten sie signifikant<br />
häufiger die zuvor dargebotene Form.<br />
In den 50er Jahren wurden viele Studien zum verdeckten Konditionieren durchgeführt. Pbn<br />
wurden dabei für spezifische Reaktionen verstärkt. Verschiedentlich wurde berichtet, daß<br />
auch Pbn, die der Verstärkungskontingenz nicht gewahr wurden, die verstärkte Reaktion<br />
häufiger zeigten (s. Übersicht bei Eriksen, 1960). Auch bei verschiedenen Arten von klassisch<br />
konditionierten Reaktionen waren sich die Pbn über die Kontingenzen nicht bewußt,<br />
allerdings wurde das Ausmaß der Bewußtheit oft nicht zufriedenstellend erhoben (Brewer,<br />
1974). Regeln können ebenfalls implizit gelernt werden (z.B. Reber, Allen & Regan, 1985).<br />
In diesen Studien wurde den Pbn eine Folge von Buchstaben dargeboten, die nach<br />
verschiedenen Regeln einer künstlichen Grammatik zusammengestellt wurden. Die Pbn<br />
lernten grammatikalisch korrekte Buchstabenfolgen zu identifizieren, auch wenn sie die<br />
dazugehörenden Regeln nicht bewußt oder explizit ausdrücken konnten. Auch Kinder lernen<br />
grammatikalisch korrekte Sätze zu bilden, ohne die Regeln explizit ausdrücken zu können.<br />
Primingexperimente zielen ebenfalls auf das implizite Gedächtnis ab. Am gebräuchlichsten<br />
sind Tests zu lexikalischen Entscheidung, Wortidentifikation und zur Wortstamm- oder<br />
Wortfragmentergänzung. In einem Test zur lexikalischen Entscheidung müssen Pbn<br />
entscheiden, ob eine gewisse Buchstabenfolge ein echtes Wort darstellt oder nicht.<br />
Auswirkungen des Primings zeigen sich in einer verkürzten Latenz bei der Entscheidung<br />
wenn das gleiche Wort ein zweites Mal dargeboten wird. (z.B. Scarborough, Gerard &<br />
Cortese, 1979). Bei der Wortidentifikation (auch tachistoskopische oder perzeptuelle<br />
Identifikation genannt) bekommen die Pbn einen Stimulus für kurze Zeit (z.B. 30 ms)<br />
dargeboten und haben die Aufgabe diesen zu identifizieren. Priming wirkt sich dahingehend<br />
aus, daß die Genauigkeit, kurz zuvor dargebotene Items zu identifizieren im Vergleich zu<br />
neuen Items zunimmt, bzw. dadurch, daß die Zeit, die zur Identifikation zuvor dargebotener<br />
Items notwendig ist, abnimmt (z.B. Jacoby & Dallas, 1981). Bei Wortergänzungstests wird<br />
den Pbn ein Wortstamm vorgegeben (z.B. tab_ _ für table) oder ein Wortfragment (z.B._ ss _<br />
ss _ _ für assassin). Die Pbn werden dazu aufgefordert den Stamm oder das Fragment mit<br />
dem ersten Wort zu ergänzen, das ihnen in den Sinn kommt. Priming wirkt sich bei diesen<br />
Tests durch eine gesteigerte Tendenz aus, den Stamm oder das Fragment mit einem Wort zu<br />
ergänzen, das aus einer Liste stammt, die den Pbn zuvor dargeboten wurde (z.B. Graf,<br />
Mandler & Haden, 1982).<br />
Viele Studien haben gezeigt, daß Manipulationen wie das Material gelernt wird einen<br />
differentiellen Effekt auf implizite und explizite Gedächtnistests haben. Winnick und Daniel<br />
(1970) ließen ihre Pbn Wortlisten unter verschiedenen Bedingungen lernen. In der ersten<br />
Bedingung bekamen sie ein bekanntes Wort visuell dargeboten und sollten es lesen. In der<br />
zweiten Bedingung bekamen sie eine Abbildung des Wortes dargeboten und sollten es<br />
benennen. In einer weiteren Bedingung bestand die Aufgabe darin das Wort aus einer<br />
Definition zu generieren. In einem Test zur Wortidentifikation war die visuelle Darbietung<br />
den elaborierteren Bedingungen überlegen. In einem Test der freien Wiedergabe war jedoch<br />
die visuelle Darbietung den beiden anderen Bedingungen, die eine elaboriertere Verarbeitung<br />
der Wörter erforderten, unterlegen. Jacoby und Dallas (1981) bestätigten diese Ergebnisse; sie<br />
boten ihren Probanden eine Liste bekannter Wörter dar und gaben ihnen eine Aufgabe, die<br />
eine elaborierte Verarbeitung der Wörter förderte (z.B. Beantwortung von Fragen über die<br />
Bedeutung des Reizwortes) oder verhinderte (z.B. Entscheidung ob das Reizwort einen<br />
bestimmten Buchstaben enthält oder nicht). Die Erinnerung der Wörter wurde mit einem<br />
ja/nein Wiedererkennenstest erfaßt. Die Ergebnisse zeigten daß explizites Gedächtnis durch<br />
die Art der Verarbeitung beim Lernen beeinflußt wurde, die Leistung im Wiedererkennenstest<br />
war besser, wenn die Wörter unter der elaborierten Bedingung gelernt wurden. Jedoch gab es