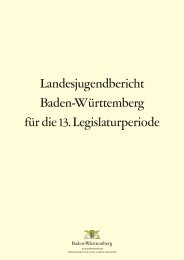Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 15<br />
So kann aktives Ignorieren eines Stimulus das Ausmaß oder die Qualität der perzeptuellen<br />
Verarbeitung beeinträchtigen (s. Kap. 3.6). Aufmerksamkeit spielt also bereits bei der frühen<br />
Verarbeitung von Stimuli eine Rolle. Paralleles Verarbeiten ist bis zu einem gewissen<br />
Ausmaß möglich, aber die Kapazitäten des sensorischen Speichers sind bald überladen, v.a.<br />
innerhalb derselben sensorischen Modalität (Duncan, 1987, Treisman & Davies, 1973).<br />
Information gelangt vermutlich ins sensorische Gedächtnis, auch wenn die Person versucht<br />
sie zu ignorieren. Scheinbar beeinträchtigt der Input von Information ins sensorische<br />
Gedächtnis nicht die Kapazitäten anderer mentaler Funktionen (Norman, 1969).<br />
Normalerweise besteht willentliche Kontrolle darüber welche Information gespeichert werden<br />
soll. Das wurde zumindest für die auditorische und visuelle Modalität nachgewiesen. Jedoch<br />
wird auch nicht willentlich selegierte Info manchmal ins KZG transferiert. Irrelevante<br />
Information, die kurze Zeit nach der wahrzunehmenden Information präsentiert wird, ersetzt<br />
diese im visuellen KZG (Loftus & Ginn, 1984).<br />
Willentliche Stimulusselektion erscheint als notwendige, möglicherweise aber nicht als<br />
hinreichende Bedingung, um Information ins KZG zu bekommen. Zentrale Interferenz<br />
(Entscheidung über eine Aktion, Abrufen von Information aus dem LZG) beeinträchtigt<br />
diesen Transfer nicht.<br />
Stilles Wiederholen ist der zentrale Mechanismus des KZG, wenn z.B. eine Anzahl von<br />
Zahlen behalten werden soll. Dabei müssen wir eine Sequenz von Zahlen erst dann stetig<br />
wiederholen, wenn die Anzahl der Items die Kapazitätsgrenze der Gedächtnisspanne erreicht<br />
hat. Es erfolgt lediglich eine leichte Interferenz durch andere Aufgaben (Pbn können nebenbei<br />
noch anspruchsvolle Denkaufgaben durchführen) (Baddeley & Hitch, 1974).<br />
Willentliche Kontrolle spielt auch beim Transfer in das LZG eine wichtige Rolle. Elaboration<br />
ist eine der effektivsten Strategien um Info ins LZG zu überführen. Der Begriff der<br />
Elaboration von Information ist eng mit dem Modell der Verarbeitungstiefe von Craik und<br />
Lockhardt (1972) verbunden. Sie gehen davon aus, daß eingehende Information in Stufen<br />
analysiert wird. Zuerst erfolgt eine Analyse der physikalisch-sensorischen Merkmale eines<br />
Worts, dann findet eine Mustererkennung statt und schließlich wird das Wort semantisch<br />
verarbeitet. Je tiefer die Verarbeitung erfolgt, desto besser kann die Information behalten<br />
werden.<br />
Der Wunsch oder die Intention Information zu speichern, hat wenig Auswirkung auf eine<br />
Langzeitspeicherung, jedoch kann es Personen motivieren Information auf unterschiedlichen<br />
Ebenen zu verarbeiten (s. Kap. 3.6 zum gelenkten Vergessen). Elaboration kann den Abruf<br />
assoziierter Info enthalten, so daß die neue Information mit schon bestehenden<br />
Wissensbestandteilen vernetzt werden kann. Abruf von Inhalten kann auch schon bestehende<br />
Gedächtnisspuren stärken.<br />
Pashler und Carrier (1996) stellen zusammenfassend fest, daß wenn sich Information im KZG<br />
befindet, dies weder eine notwendige noch eine hinreichende Bedingung darstellt, um ins<br />
LZG zu gelangen. Konkurrierende Aufgaben, die zentrale Verarbeitung und damit<br />
Aufmerksamkeit erfordern, zeigen große Effekte auf die Gedächtnisleistung, selbst wenn<br />
unterschiedliche sensorische Modalitäten beteiligt sind und keine offene Reaktion gefordert<br />
wird. Diese Ergebnisse unterscheiden sich somit von den Ergebnissen zum KZG. Jedoch gibt<br />
zahlreiche Einschränkungen dieser Feststellung und Beispiele, in denen Zweitaufgaben das<br />
LZG nicht beeinträchtigt haben. Auch Ergebnisse dazu, ob konkurrierende Aufgaben, die<br />
zentrale Verarbeitungskapazitäten beanspruchen, mit dem Abruf vom LZG interferieren, sind<br />
uneinheitlich. Jedoch sprechen sie eher für eine Interferenz.<br />
Aufmerksamkeit kann als organisierendes Konzept bezeichnet werden und ist, wie dargelegt,<br />
am Transfer von Information sowohl vom sensorischen Gedächtnis ins KZG als auch vom