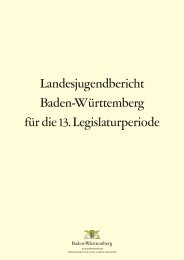Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 92<br />
Umstände unter denen sie diese Information gelernt haben vergessen. Für Kihlstrom und<br />
Schacter (1995) sind sowohl Interferenz als auch Quellenamnesie Ausdruck des impliziten<br />
Gedächtnisses und sie meinen, daß die Dissoziation zwischen den alter egos das explizite,<br />
nicht aber das implizite Gedächtnis betreffen.<br />
Im Fall von Alice konnten Nissen et al. (1988) einen Transfer bei impliziten<br />
Gedächtnisaufgaben zwischen verschiedenen Alter Egos nachweisen. Jedoch fand dieser<br />
Transfer nicht bei allen impliziten Gedächtnisaufgaben statt. So wurde bei einer Aufgabe zur<br />
Wortfragmentergänzung (es gibt nur eine mögliche Lösung) ein Transfer beobachtet, nicht<br />
aber bei einer Aufgabe zur Wortstammergänzung (es gibt mehrere Lösungen).<br />
Eich et al. (1997) konnten diese Ergebnisse replizieren. Das Testen des impliziten<br />
Gedächtnisses ist eine notwendige aber nicht hinreichende Bedingung um einen Transfer von<br />
gelernten Inhalten zwischen den Persönlichkeiten aufzuzeigen. Dieser Transfer konnte<br />
eindrücklich anhand einer Bildfragmentergänzung aufgezeigt werden, nicht aber bei einem<br />
Test zur Wortstammergänzung. Es scheint so als ob der Transfer zwischen den Alter Egos<br />
davon abhängt wie stark Kodierungs- und Abrufprozesse von spezifischen Merkmalen der<br />
jeweiligen Persönlichkeit beeinflußt werden.<br />
Funktionelle Amnesien werden fast immer mit Dissoziativen Amnesien gleichgesetzt und<br />
diese wiederum mit dem hypothetischen Prozeß der Dissoziation. Die erste theoretische<br />
Ausarbeitung des Konzepts erfolgte durch Janet (1894, 1907), andere entwickelten das<br />
Konzept weiter (z.B. Hilgard, 1977, 1991). Janet nahm an, daß es eine große Anzahl<br />
spezialisierter Einheiten im Gehirn gibt, die Wahrnehmung und Handlung kombinieren<br />
(psychologische Automatismen). Das gesamte Repertoir psychologischer Automatismen,<br />
wird in einen einzelnen Bewußtseinsstrom überführt. Durch Streß kann jedoch einer dieser<br />
Automatismen oder ein ganzes Set von Automatismen vom Bewußtseinsstrom abgespalten<br />
werden und so isoliert von Bewußtsein und willentlicher Kontrolle weiterhin aktiv sein. Die<br />
psychologischen Automatismen beeinflussen weiterhin Erfahrung, Denken und Handeln einer<br />
Person, jedoch unbewußt. Auf diese Weise erklärte Janet die Entstehung hysterischer<br />
Phänomene (s. Kihlstrom, Glisky & Angiulo, 1994; Kap. 3.10).<br />
Bei Amnesien in Verbindung mit Dissoziativen Störungen sind gewisse Gedächtnisinhalte<br />
von einem bewußten Zugang ausgeschlossen. Trotzdem sind diese Amnesien reversibel und<br />
sind also ausreichend kodiert und gespeichert. Die Inhalte können, wie dargestellt, zumindest<br />
teilweise implizit ausgedrückt werden, ohne daß sich die Person dessen bewußt ist. Somit<br />
stellen sich die klassischen funktionellen Störungen, deren Mechanismus als dissoziativ<br />
beschrieben wurde, als eine Störung des Gedächtnisabrufs dar. Funktionelle<br />
Gedächtnisstörungen müssen jedoch nicht unbedingt dissoziativ sein und sie müssen nicht<br />
unbedingt Ausdruck eines Defizits beim Abruf sein (Kihlstrom & Schacter, 1995). Laut<br />
Singer (1990) unterliegt manchen funktionellen Amnesien eher der Mechanismus der<br />
Verdrängung. Beide Mechanismen stellen eine Beeinträchtigung dar bewußt auf<br />
Gedächtnisinhalte zuzugreifen, sind prinzipiell reversibel und Störungen des Abrufs. Im Fall<br />
der Verdrängung handelt es sich jedoch immer um affektgeladene Inhalte, die vom<br />
Bewußtsein verbannt wurden um Angst abzuwehren. Dissoziation kann alle<br />
Gedächtnisinhalte betreffen, positive, neutrale und negative und dient nicht der Abwehr.<br />
Verdrängung ist eines der Fundamente von Freuds psychoanalytischer Theorie und wurde zur<br />
Erklärung von Gedächtnisstörungen in Zusammenhang mit PTSD gebracht (s. Kap. 4.6).<br />
Jedenfalls haben Patienten mit DIS (44) wie auch mit PTSD (30) wesentlich höhere Werte auf<br />
der Dissociative Experience Scale (DES) als gesunde Personen (10) (Putnam, 1997).<br />
Putnam (1997) sieht Dissoziation neben dem Auftreten im Alltag auch als einen<br />
Abwehrmechanismus und findet drei Kategorien, die sich überschneiden können:<br />
• Automatisierung von Verhalten: In diese Kategorie fallen alle Episoden automatisierten<br />
Verhaltens, die nicht von bewußtem Denken gesteuert werden. Dieses Verhalten kann