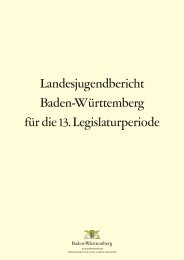Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 17<br />
voneinander getrennte Gedächtnissysteme (verbal versus räumlich-visuell) sprechen. Bei<br />
Bjork hat außerdem die Rolle des zentralen Prozessors eine andere Funktion; er setzt diesen<br />
mit zentraler Aufmerksamkeit gleich.<br />
Ähnlichkeiten gibt es auch mit dem Modell des Arbeitsgedächtnis von Baddeley (1986).<br />
Jedoch bestehen Unterschiede beim Abruf, daran ist nämlich die zentrale Exekutive nach<br />
Baddeley nicht beteiligt. Er ist der Meinung, daß ein mit einem Cue assoziierter Abruf<br />
automatisch erfolgt. Jedoch deuten experimentelle Daten laut Pashler und Carrier (1996) eher<br />
darauf hin, daß der Abruf von Information nicht automatisch erfolgt. Ohne perzeptuelle<br />
Aufmerksamkeit würde ein Abrufcue wohl nicht ausreichend verarbeitet um einen Abruf<br />
stattfinden zu lassen (s. Kap. 3.1).<br />
Zusammenfassend ist festzuhalten, daß die Konzeption eines Mehrspeichermodells, auch<br />
unter Berücksichtigung neuerer empirischer Daten, immer noch aktuell ist. Es gibt<br />
Anhaltspunkte dafür, daß unterschiedliche Information in verschiedene Speicher gelangt, die<br />
voneinander abgegrenzt werden können. Sicherlich muß die Gültigkeit des Modells von<br />
Pashler und Carrier (1996) teilweise empirisch noch nachgewiesen werden, es gibt jedoch<br />
einen differenzierteren Eindruck davon, wie Information vom Sinneseindruck zum<br />
Gedächtnisinhalt wird, als das ursprüngliche Mehrspeichermodell von Atkinson und Shiffrin<br />
(1968).<br />
2.2 Explizites versus implizites Gedächtnis<br />
Psychologische Studien über das Gedächtnis haben sich traditionell Weise meist auf Tests wie<br />
freie Wiedergabe, Wiedergabe auf einen Cue hin und Wiedererkennen berufen. Diese Tests<br />
stellen einen expliziten Bezug zu einer spezifischen Lernepisode her und erfordern deren<br />
bewußte Wiedergabe. Schacter (1987) bezeichnet das Gedächtnis, auf das so zugegriffen<br />
werden kann, als explizites Gedächtnis. Er grenzt diesen Begriff vom impliziten Gedächtnis<br />
ab. Das implizite Gedächtnis enthält Informationen, die während einer bestimmten Episode<br />
gespeichert wurden, die zu einem späteren Zeitpunkt ohne bewußte oder willentliche<br />
Anstrengung ausgedrückt werden können. Pbn werden dabei nicht aufgefordert etwas zu<br />
erinnern, sondern werden z.B. dazu angehalten gewisse Aufgaben wie die Ergänzung eines<br />
Wortfragments durchzuführen, ihre Präferenz für einen unter mehreren Stimuli auszudrücken,<br />
oder spiegelverkehrte Schrift zu lesen. Daß das Gedächtnis Einfluß auf diese Aufgaben hat,<br />
wird anhand von Auswirkungen auf die Leistung in Tests festgemacht, die auf den Erwerb<br />
von Information in einer vorausgegangenen Lernphase zurückgehen.<br />
Jüngere kognitive und neuropsychologische Studien haben eine Vielzahl von Dissoziationen 3<br />
von explizitem und implizitem Gedächtnis aufgezeigt. Unter bestimmten Bedingungen<br />
arbeiten explizites und implizites Gedächtnis anscheinend völlig unabhängig voneinander. Es<br />
handelt sich bei den Begriffen „implizit“ und „explizit“ um deskriptive Konzepte, was<br />
bedeutet, daß sie v.a. auf die psychologische Erfahrung einer Person zum Zeitpunkt des<br />
Abrufs abzielen. Somit implizieren sie nicht unbedingt die Existenz zweier unabhängiger oder<br />
getrennter Gedächtnissysteme. Rubin (1995) merkt jedoch an, daß eine Vielzahl von<br />
Aufgaben sowohl das explizite als auch das implizite Gedächtnis mit einbeziehen und führt<br />
das am Beispiel der Rezitation volkstümlicher Epen näher aus.<br />
Schon früh wurden von aufmerksamen Klinikern, aber auch von Philosophen und<br />
Experimentalpsychologen Hinweise auf Gedächtnisphänomene gegeben, in denen ein<br />
Gedächtnisinhalt ausgedrückt wird, dieser aber keinem Ereignis in der Vergangenheit<br />
3 Zur Erläuterung des Begriffs Dissoziationen im Kontext der Gedächtnisforschung s. Kap. 2.