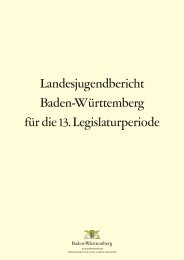Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 135<br />
auch den klinischen Bereich ausgewiesen. Sie verzichtet auf eine formale Hypnoseinduktion,<br />
kann daher auch als Imaginationstest angekündigt werden und korreliert dann wesentlich<br />
niedriger mit anderen Hypnotisierbarkeitsskalen. Niedrighypnotisierbare erzielen in diesem<br />
Fall aber höhere Werte, als wenn die Skala als ein Meßinstrument zur Erfassung der<br />
Hypnotisierbarkeit angekündigt wird (Spanos et al., 1989).<br />
Trancetiefeskalen erheben den subjektiven Trancezustand zu einem gewissen Zeitpunkt der<br />
Hypnosesitzung. Sie korrelieren in der Regel hoch mit Hypnotisierbarkeitsskalen, v.a. wenn<br />
die Trancetiefeschätzung automatisch abgegeben wird. Auf diese Weise können auch<br />
Fluktuationen der Trancetiefe im Verlauf einer Sitzung erfaßt werden. Darüber hinaus gibt es<br />
auch Methoden bei denen die Trancetiefe retrospektiv eingeschätzt wird, anhand eines<br />
Fragebogens oder in einem kooperativen Gespräch zwischen Hypnotiseur und Hypnotisand<br />
(Krause, 2000).<br />
Bisher nicht ganz geklärt ist ob die Hypnotisierbarkeitsskalen nur einen Faktor messen. Die<br />
Verteilung von Hypnotisierbarkeitswerten ist bimodal. Verteilungen von SHSS A und B<br />
Scores, die anhand von 124 Pbn ermittelt wurden, zeigen zwei Gipfel, einen bei einem Wert<br />
von vier, den anderen bei zehn. (Hilgard et al., 1961). Auch geht aus faktorenanalytischen<br />
Untersuchungen der Stanford Skalen hervor, daß sie zwei oder sogar mehrere Faktoren<br />
enthalten.<br />
Hilgard (1965) vertritt die Meinung, daß zumindest die Stanford-Skalen vor allem einen<br />
Faktor messen, dazu mißt aber jedes Item noch spezifische Faktoren, die alle<br />
Dissoziationsaspekte beinhalten. Viele andere Autoren bevorzugen jedoch eine andere<br />
Interpretation der Daten und nehmen zwei Mechanismen an, die je nach Itemschwierigkeit<br />
hypnotische Reaktionen unterschiedlich beeinflussen. Ein Faktor ist wichtiger bei einfachen<br />
Items, der andere kommt eher bei schwierigen Items zur Geltung (Balthazard, 1993). Je nach<br />
theoretischer Ausrichtung werden die beiden Faktoren unterschiedlich benannt: z.B. primäre<br />
Suggestibilität und Somnambulismus (Weitzenhoffer), begrenzte versus umfangreiche<br />
Dissoziation (Hilgard), Compliance und echte Hypnose (Tellegen), Kooperation-Erwartungen<br />
und Absorption (Spanos) (s. Balthazard, 1993).<br />
Andere Faktorenanalysen hypnotischer Reaktionsbereitschaft ergaben drei Kategorien<br />
hypnotischer Reaktionen. Eine umfaßt ideomotorische Reaktionen (z.B. Bewegung der Hände<br />
zueinander), eine andere Challenge-Items (z.B. Unfähigkeit den Arm zu beugen) und eine<br />
dritte Kategorie enthält posthypnotische Suggestionen, Halluzinationen und Amnesie (z.B.<br />
Hammeret al., 1963; Hilgard, 1965). Jedes Item in diesen Kategorien steht in einer engeren<br />
Beziehung zu den Items der gleichen Kategorie als zu Items der anderen Kategorien.<br />
Ein anderer Ansatz kommt von Pekala und Forbes (1997). Sie erhoben die Tranceerfahrung<br />
von Pbn beim Durchlaufen der HGSHS:A. Eine Clusteranalyse ergab neun Subgruppen, die<br />
unterschiedliche phänomenologische Erfahrungen in der Trance gemacht hatten. Diese<br />
Gruppen konnten auch anhand von Mittelwerten der HGSHS:A unterschieden werden. Die<br />
Ergebnisse zeigen, z.B.daß eine der Gruppen eine hohe Hypnotisierbarkeit durch intensiven<br />
Gebrauch von visueller Vorstellung erreicht, während die andere Gruppe kaum visuelle Bilder<br />
gebraucht, um vergleichbare Werte zu erzielen (s. auch Barrett, 1996).<br />
Wie schon in Kap. 3.10 und Kap. 4.7.6 erwähnt gilt Dissoziation in manchen theoretischen<br />
Ansätzen als ein zentraler Mechanismus der Hypnose, indem motorische, sensorische oder<br />
auch komplexere kognitive Subsysteme sich von der bewußten Steuerung einer zentralen<br />
Kontrollinstanz abkoppeln und autonom tätig werden (Hilgard, 1977, 1991). Zusammengefaßt<br />
läßt sich festhalten, daß Parallelen zwischen kontrollierten dissoziativen Zuständen in<br />
Hypnose und Psychiatrischen Störungen (z.B. Dissoziative Störungen, PTSD) gibt (s. Kap.<br />
4.5, Kap. 4.6). Die Dissoziation stellt bei diesen Störungen einen adaptiven Mechanismus der<br />
Patienten dar, um sich vor traumatischen Schmerzen oder Emotionen zu schützen (z.B. Butler<br />
et al., 1996). Neuere Studien zeigen jedoch, daß dissoziative Erfahrungen im Alltag