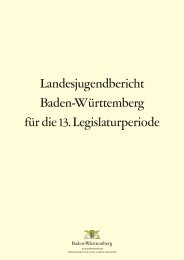Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 78<br />
worden waren; 56 % hatten sich nicht verändert, während 32 % sich verbesserten, die<br />
restlichen 12 % zeigten verschlechterte Gedächtnisleistungen.<br />
Gute Gedächtnisleistungen zeichnen sich dadurch aus, daß Information so genau wie möglich<br />
wiedergegeben wird. Das betrifft nicht nur die Erinnerung der Information sondern auch die<br />
Reproduktion von Merkmalen des Kontexts in dem das Lernen erfolgte. Haben Patienten mit<br />
Hirntraumata Schwierigkeiten mit beiden aufgeführten Aspekten, führt dies zu Verzerrungen<br />
und ungenauer Wiedergabe. Diese Verzerrungen können auch die Quelle einer Information<br />
betreffen, die erinnert werden soll. Patienten die länger im Koma lagen, zeigten eher<br />
Anzeichen einer Quellenamnesie (Goldberg & Levin, 1995).<br />
Die Leistungen bei Tests der verzögerten Wiedergabe waren bei Patienten mit Hirntraumata<br />
überproportional schlechter, als die Leistungen bei unmittelbarer Wiedergabe. Wenn sie Items<br />
unmittelbar reproduzieren können, zeigen auch sie einen normalen Recency-Effekt. Solche<br />
Schwierigkeiten bei verzögerter Wiedergabe wurden oft im Zusammenhang mit<br />
Transferproblemen vom KZG ins LZG interpretiert (s. Kap. 2.1, 3.7). Die Patienten können<br />
möglicherweise deshalb keine Inhalte im LZG bilden, da sie Information schnell wieder<br />
vergessen, was auf einen beeinträchtigten Transfer vom KZG ins LZG oder auf einen Verlust<br />
der Information, nachdem sie im LZG angekommen ist, zurückzuführen ist. Vielleicht ist bei<br />
der verzögerten Wiedergabe auch die erhöhte Vulnerabilität für Interferenz durch<br />
Distraktoraufgaben für die schlechte Gedächtnisleistung verantwortlich. Ursache für die<br />
erhöhte Vulnerabilität für Interferenz könnte in der Unfähigkeit liegen gezielte<br />
Aufmerksamkeit für die eigentliche Aufgabe aufrechtzuerhalten, wenn interferierende<br />
Aufgaben dargeboten werden. Auch ein Mangel an aktiven und organisierten Abrufstrategien<br />
wird immer wieder bei Patienten mit Hirntraumata genannt, was möglicherweise auf eine<br />
Beeinträchtigung der Frontallappen zurückzuführen ist. Wie schon erwähnt sind die Läsionen<br />
bei Schädel-Hirn-Traumata eher diffus und deren Auswirkungen lassen sich nicht unbedingt<br />
anhand der Lokalisation in einem bestimmten Gehirnareal festmachen (Goldberg & Levin,<br />
1995).<br />
Der neuste Stand der Forschung läßt vermuten, daß Patienten mit Hirnverletzungen<br />
semantische Beziehungen benutzen um ihr Lernen zu strukturieren. So erinnern sie z. B. mehr<br />
Wörter, die Kategorien angehören als Wörter, die keine konzeptuelle Beziehung teilen.<br />
Verarbeiten die Patienten Wörter semantisch, so profitieren sie gegenüber Bedingungen in<br />
denen sie die Wörter lediglich phonemisch oder nach physikalischen Eigenschaften<br />
verarbeiten. Auch zeigen Patienten in der Rehabilitation Erholung von proaktiver Interferenz,<br />
was darauf hindeutet, daß sie den Wechsel von einer Kategorie zur anderen verwerten um die<br />
Information in Verbindung mit kategorialen Cues neu zu strukturieren (s. Kap. 3.3). Obwohl<br />
PTA Patienten semantische Information verarbeiten, können sie das nicht so effektiv, wie<br />
gesunde Personen. Sie verwenden inaktive Strategien, organisieren den Abruf in weniger<br />
Kategorien als gesunde Pbn und sind langsamer darin semantische Entscheidungen zu fällen<br />
(z.B. Ist ein Stuhl ein Möbel?), obwohl sie nicht mehr Fehler dabei begehen.<br />
Diese Ergebnisse legen nahe, daß Patienten mit PTA in der Rehabilitation Strategien<br />
vermittelt werden sollten, die das Clustern von Information sowohl beim Kodieren als auch<br />
beim Abruf erleichtern. Zudem brauchen sie mehr Zeit um die Bedeutung der zu lernenden<br />
Information zu verarbeiten (Goldberg & Levin, 1995).<br />
4.2 Amnesie bei Demenzen<br />
Demenz ist ein allgemeiner Begriff, mit dem neuropsychiatrische Syndrome bezeichnet<br />
werden, die durch erworbene Beeinträchtigungen in mehreren kognitiven Bereichen<br />
gekennzeichnet sind, jedoch nicht das Bewußtsein beeinträchtigen (z.B. Brandt & Benedict,<br />
1993). Obwohl die kognitiven Syndrome bei verschiedenen Demenzen etwas variieren,