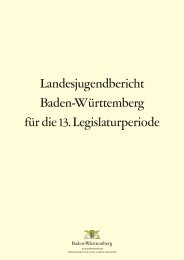Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 142<br />
Ausmaß, in dem Emotionen aktualisiert werden können, scheint mit der Hypnotisierbarkeit<br />
zusammenzuhängen.<br />
Die Erhebung der Trancetiefe auf einer eindimensionalen mehrstufigen Skala stellt ein<br />
einfaches und unkompliziertes Maß dar, anhand dessen die Hypnotisierbarkeit von Personen<br />
geschätzt werden kann. Hier sollte noch genauer der Zusammenhang zwischen Trancetiefe<br />
und der Empfänglichkeit für Hypnose abgeklärt werden. So ist z.B. noch nicht bekannt<br />
welcher Zeitpunkt im Verlauf einer Induktion die beste Schätzgröße für die<br />
Hypnotisierbarkeit darstellt.<br />
Insgesamt handelt es sich bei den vorhandenen Hypnotisierbarkeitsskalen um effektive<br />
Werkzeuge, die viel Information zur Diagnostik für eine Therapie mit Hypnose liefern.<br />
5.3 Effektivität der Therapie mit Hypnose<br />
Grawe, Donati und Bernauer (1994) befinden, daß Hypnose ein effektives Therapeutikum ist.<br />
Ein ansehnlicher Forschungsaufwand wurde betrieben um Hypnose empirisch abzusichern.<br />
So berichtet Nash (2000) von über 7000 Publikationen im Zusammenhang mit Hypnose, die<br />
seit 1966 in über 150 Fachzeitschriften (medizinische, psychologische und interdisziplinäre<br />
Zeitschriften) veröffentlicht wurden.<br />
Der Erfolg einer Therapie mit Hypnose ist auf der Verhaltensebene oft leicht nachzuweisen,<br />
so kann ein Erfolg bei der Raucherentwöhnung anhand des reduzierten Zigarettenkonsums,<br />
bei der Schmerzbewältigung anhand eines reduzierten Medikamentengebrauchs, bei der<br />
Bewältigung von Ängsten anhand der Konfrontation mit dem angstauslösenden Stimulus und<br />
eine Verbesserung der depressiven Symptomatik anhand der Aktivitätserhöhung<br />
operationalisiert werden (s. Revenstorf, 2000d). Bei somatischen Krankheiten wie der<br />
atopischen Dermatitis oder der Psoriasis kann ein Erfolg der Intervention über eine Erhebung<br />
der Größe der betroffenen Hautregion nachgewiesen werden, bei Krebserkrankungen durch<br />
eine verlängerte Überlebensdauer (z.B. Spiegel et al., 1989).<br />
Der Erfolg einer Behandlung bei chronischen Erkrankungen (wie z.B. Schmerzen, Psoriasis)<br />
kann zusätzlich über eine Erhöhung der Lebensqualität erhoben werden. Für diese<br />
Krankheitsbilder gibt es auch schulmedizinisch keine Heilung und deshalb sollten sich auch<br />
psychologische Therapien, wie die Hypnose nicht allzusehr auf eine symptomorientierte<br />
Behandlung konzentrieren. Therapieziele können in diesem Fall auch eine verbesserte<br />
Akzeptanz und ein verbesserter Umgang mit der Krankheit sein, um so den Leidensdruck für<br />
die Betroffenen zu senken. Somit ist eine eher konfliktorientierte Vorgehensweise der<br />
Hypnose indiziert. In einer Studie vergleicht Hoppe (1993) Schmerzpatienten mit und ohne<br />
Organbefund. Für erstere erweist sich eine symptombezogene Hypnotherapie, für die andere<br />
eine problembezogene Vorgehensweise als erfolgreicher. Aus solchen Erkenntnissen ergeben<br />
sich differentielle Indikationen für spezifische Techniken aus dem Repertoir der Hypnose.<br />
Revenstorf (2000d) stellt zurecht heraus, wie schwierig es ist besonders den Erfolg von<br />
indirekten therapeutischen Interventionen kausal nachzuweisen. Ein Ziel oder sogar ein<br />
definierendes Element einer Suggestion ist, daß der Suggestand (der Empfänger der<br />
Suggestion) die Beeinflussung durch den Suggestor nicht bewußt wahrnehmen darf (Lundh,<br />
2000). Natürlich weiß der Patient in einem hypnotherapeutischen Setting, daß er sich in einer<br />
Situation befindet, in der er beeinflußt wird. Doch ist es ein Ziel der indirekten<br />
Vorgehensweise, Suggestionen am Zensor des Wachbewußtseins vorbei zu geben, um so<br />
implizite Bedeutungsstrukturen zu aktivieren. Zeigt der Patient vielleicht Tage später ein<br />
verändertes Verhalten, so kann er dieses eher internal und stabil attribuieren und nicht als eine<br />
durch den Therapeuten obstruierte Verhaltensverschreibung. Eine Möglichkeit indirekten<br />
Vorgehens besteht in der Verwendung von Metaphern und Geschichten, die meistens mehrere<br />
Bedeutungsebenen haben, die der Patient implizit oder explizit auf seine Situation übertragen