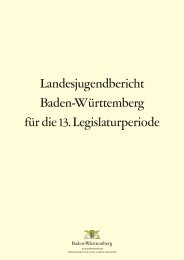Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Dekan: Prof. Dr. Martin Hautzinger - Universität Tübingen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Clemens Krause: Posthypnotische Amnesie für therapeutische Geschichten 13<br />
Bei den Mehrspeichermodellen handelt es sich um funktionale und nicht um<br />
neurophysiologische Konzepte, auch wenn neuroanatomische Strukturen nachgewiesen<br />
wurden, die den Charakteristiken einzelner Speicher entsprechen könnten (s. Kap. 2.4). Der<br />
Informationsverarbeitungsansatz geht davon aus, daß verschiedene Codes in einzelnen<br />
Gedächtnissystemen, die sich anhand zeitlicher und anderer Eigenschaften unterscheiden, zur<br />
Anwendung kommen.<br />
Ein Mehrspeichermodell, welches verschiedene Gedächtnissysteme postuliert, kann nach<br />
Pashler und Carrier (1996) dann als gesichert gelten, wenn nachgewiesen werden kann, daß:<br />
• das Überladen eines Systems die Kapazitäten eines anderen nicht beeinflußt.<br />
• Läsionen ein System selektiv beeinträchtigen. Idealerweise können die einzelnen Systeme<br />
selektiv außer Kraft gesetzt werden.<br />
• experimentelle Variablen Auswirkungen auf nur ein System und nicht auf andere zeigen,<br />
was bedeutet, daß es zu einer funktionalen Dissoziation zwischen den einzelnen Systemen<br />
kommt (s. Kap. 2).<br />
Der erste Versuch das menschliche Gedächtnis in verschiedene Systeme zu unterteilen<br />
stammt von Atkinson & Shifrin (1968). Das Modell postuliert drei Speicherysteme, das<br />
sensorische Gedächtnis, das Kurzzeitgedächtnis (KZG) und das Langzeitgedächtnis (LZG).<br />
Im visuellen sensorischen Gedächtnis (auch ikonisches Gedächtnis genannt) bleibt nach<br />
kurzer Präsentation eines visuellen Stimulus eine sensorische Spur dieses Stimulus mehrere<br />
hundert Millisekunden bestehen. Diese Spur stellt phänomenologisch eine zerfallende Version<br />
des Stimulus selbst dar. Über die exakte Speicherkapazität ist wenig bekannt. Jedoch ist sie<br />
wesentlich größer als die des KZG und beträgt ca. 12 Buchstaben. Das auditive sensorische<br />
Gedächtnis (echoisches Gedächtnis) behält Information wesentlich länger als das ikonische<br />
Gedächtnis (ein bis zwei Sek.) jedoch erscheint dessen Speicherkapazität begrenzter.<br />
Es bereitet bisher Schwierigkeiten dieses System zu erklären. Im Allgemeinen schwinden<br />
Szenen der realen Welt nicht so schnell wie in den experimentellen Versuchsanordnungen. Es<br />
ist unwahrscheinlich, daß das sensorische Gedächtnis lediglich eine Stufe hin zu späteren<br />
Gedächtnisrepräsentationen ist. Auch die Funktion des sensorischen Gedächtnis bleibt<br />
fraglich; vielleicht hält es visuelle Eindrücke gerade so lange um die Zeit während des<br />
Augenblinzelns zu überbrücken (Pashler & Carrier, 1996).<br />
Das KZG wird nach Pashler und Carrier (1996) meist so dargestellt als wäre es ein<br />
einheitliches System, jedoch hatten schon Attkinson und Shiffrin (1968) die Vermutung, daß<br />
es mehr als ein KZG System gibt und es gibt Hinweise darauf, daß sie damit richtig lagen.<br />
Die überzeugendsten Anhaltspunkte für eine Unterscheidung von KZG und LZG kommen aus<br />
der Amnesieforschung.<br />
So zeigen Patienten mit anterograder Amnesie oft normale Leistungen bei seriellen<br />
Erinnerungsaufgaben wenn diese sehr kurz gehalten sind und der Abruf unmittelbar erfolgt (s.<br />
Kap. 4). Ablenkung zwischen Lerndurchgang und Abruf muß dabei ausgeschlossen werden.<br />
Mit Amnestikern ist normale Konversation möglich solange man den Raum nicht verläßt. Tut<br />
man dies und kommt zurück, so ist das Gespräch vergessen. Nach Milner (1958) ist eine<br />
Störung des Transfers der Information vom KZG ins LZG für diese Beeinträchtigung des<br />
Gedächtnis verantwortlich.<br />
Bei anterograden Amnestikern ist ein intakter Recency-Effekt zu beobachten, der laut<br />
Meinung mancher Forscher deshalb besteht, da die letzten Items noch im KZG vorhanden<br />
sind und von dort abgerufen werden. Diese Annahme wird jedoch kritisiert: Auch bei<br />
Erinnerungen von Ereignissen, die Wochen oder Monate zurücklagen, konnte ein Recency-<br />
Effekt aufgezeigt werden, so daß nicht unbedingt klar ist, daß der Recency-Effekt Ausdruck<br />
der Aktivität des KZG sein muß (Baddley & Hitch, 1977). Nichtsdestotrotz zeigen